Marc W. Kirschner & John C. Gerhart: „The Plausibility of Life. Resolving Darwin’s Dilemma“
Yale University Press New Haven and London 2005, 314 S.Nachfolgend eine Rezension von Reinhard Junker:
Wenn Biologen glauben, die Mechanismen für die Entstehung evolutiver Neuheiten (Makroevolution) oder wenigstens wesentlicher Aspekte davon aufgedeckt zu haben, räumen sie häufig ein, daß Makroevolution zuvor ein noch nicht oder jedenfalls nicht befriedigend gelöstes Problem war. So auch Marc Kirschner und John Gerhart, denn sie behaupten schon im Untertitel des Buches, „Darwins Dilemma“ lösen zu können; sie sind sogar der Auffassung, daß erst mit dem Wissen, das Ende des 20. Jahrhunderts bekannt wurde, die Frage nach der Entstehung evolutiver Neuheiten angegangen werden kann. Ihre eigene „Theorie der erleichterten Variation“ („theory of facilitated variation“) verstehen sie nicht als Konkurrentin der Synthetischen Theorie, sondern als deren Vervollständigung (S. 29). Ein Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution wird implizit vorausgesetzt, wenn von „novelty“ (z.B. S. xiii) gesprochen wird, die ihre Theorie im Gegensatz zu bisherigen Versuchen erklären könne.
Grundgedanken des Buches

Die Anzahl der Gene des Menschen (22.500) ist viel zu gering, um auf der Ebene des Erbguts dessen Evolution erklären zu können (8, 156). Der Schlüssel müsse daher in den Prozessen liegen, die den Genotyp und den Phänotyp (Erscheinungsbild) miteinander verbinden (12). Entscheidend sei die Art und Weise, wie die Gene kombiniert werden (156). Selektion benötige, um effektiv zu sein, eine vorselektierte Anzahl von Varianten; es komme also auf die Natur der Variation an, die sich im Erscheinungsbild des Organismus zeigt (phänotypische Variation). Oder wie Erwin (2005, 177) in seiner Rezension treffend schreibt: „… Kirschner and Gerhart clearly feel that natural selection needs some help.“ Hier sind Mechanismen der Variationserzeugung (evolvability) entscheidend (13), Mechanismen einer „erleichterten Variation“, nach welchen die Autoren ihre Theorie benannt haben. Varianten, die der Selektion angeboten werden, müssen sozusagen vorsortiert sein. Diese Mechanismen sind aber auf der genetischen Ebene nicht zu finden (13, 27). Da die Synthetische Evolutionstheorie diese Ebene aber im Vordergrund sah, ist sie zur Erklärung der Entstehung der benötigten Variabilität nicht ausreichend (14). Ihr fehle eine „dritte Säule“, um die Möglichkeit des evolutionären Wandels zu erklären. Diese dritte Säule ist eine Theorie darüber, wie genetische Variation bei der Erzeugung von erblicher phänotypischer Variation genutzt wird (14); es geht also um die „Variations-Komponente“ im Evolutionsprozeß (220). Die hauptsächliche Angriffsfläche für erbliche Veränderungen ist die Regulation – kleine Änderungen von Merkmalen von Proteinen, RNA und DNA, welche die Zeit, die Umstände und das Ausmaß der Aktivitäten der Prozesse bestimmen (36).
Die Autoren diskutieren drei Kennzeichen von Lebewesen, die eine Evolvierbarkeit und die Entstehung von Neuem ermöglichen bzw. erleichtern sollen:
- Schwache regulatorische Verbindungen („weak regulatory linkage“; Kap. 4),
- exploratives („erforschendes“) Verhalten („exploratory behaviour“, Kap. 5) und
- Modularität und damit zusammenhängend „unsichtbare Anatomie“ (Kompartimentierung, Kap. 6).
Sie gebrauchen ein Bild, um das Zusammenwirken dieser Kennzeichen zu beschreiben: „Statt wie ein betrunkener Seemann hin und her zu torkeln, verläuft Evolution entlang zehntausender gebahnter Wege, verändert dabei ihre Richtung ohne Anleitung und macht große, kräftige Schritte und vermeidet viele tödliche Hindernisse“ (247).
Die drei genannten Kennzeichen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.
„Schwache regulatorische Verbindungen.“ Da es überraschenderweise nur wenig Gene gibt und die Kernprozesse im Stoffwechsel und in der Vererbung extrem konservativ (d. h. bei verschiedensten Organismen weitgehend identisch) sind, ist anzunehmen, daß Komplexität durch vielfachen Gebrauch und unterschiedliche Kombination relativ weniger konservierter Elemente erzeugt wird (109). Zu den Kernprozessen rechnen die Autoren die Mechanismen der Vererbung, die Art der genetischen Codierung, das grundlegende zelluläre Inventar, die subzellulären Komponenten, die wichtigsten Stoffwechselvorgänge und viele grundlegende Prozesse in der Embryonalentwicklung (2). Die unterschiedliche Kombinierbarkeit z. B. von Stoffwechselprozessen wird durch deren leichte und unspezifische Verknüpfbarkeit ermöglicht: Schwache regulatorische Verbindungen. Damit ist eine indirekte, anspruchslose, wenig Information beinhaltende Art der regulativen Verknüpfung gemeint, die leicht aufgebrochen und für andere Zwecke neu geknüpft werden kann (111). Das heißt: Steuerungssignale lösen eine Antwort aus, ohne spezifische Information zu vermitteln, wie die Antwort aussehen soll. Beispielsweise ist bei der Regulation des Milchzucker-Abbaus bei Bakterien die Verbindung zwischen Signal (Milchzucker) und Antwort (RNA-Synthese) indirekt und bietet viele Möglichkeiten, die Genregulation zu verändern (118). Die Autoren verweisen zur Veranschaulichung auf standardisiertes Design als Analogie zur Technik. Diese Situation erlaube ohne viel Aufwand neue Verknüpfungen und damit einhergehende Veränderungen und erleichtere somit den evolutiven Wandel (223).
Exploratives Verhalten. Exploratives Verhalten gibt es in der Ontogenese (Individualentwicklung). Gemeint sind Mechanismen, welche Variation erzeugen, die weitgehend zufällig und sehr wenig determiniert sind, die aber durch äußere Signale in bestimmte Richtungen gesteuert werden (144). Explorative Systeme sind „antwortend“, d. h. sie reagieren auf äußere Signale. Als Beispiele besprechen die Autoren u. a. das Wachstum des Zellskeletts, das Muskelwachstum, das Nervensystem und die Bildung des Blutgefäßsystems. So kann sich das Nervensystem mit wenigen Regeln selbst konstruieren (145). Das Wachstum erfolgt gemäß weniger Regeln, die genaue Ausprägung wird durch Randbedingungen gesteuert. Sind die Randbedingungen verschieden, resultiert ein anderes Ergebnis des Wachstums.
Kirschner & Gerhart spekulieren nun, daß durch Abwandlung der Rahmenbedingungen, in denen das explorative Verhalten von Gewebewachstum verläuft, Evolution kanalisiert voranschreiten könne und die Entstehung von Neuem erleichtert werde. Man könnte sagen: Die Variabilität und Selektion explorativer Prozesse in der Ontogenese werden bei der Phylogenese „kopiert“. Die Idee ist beispielsweise, daß ein veränderter Knochenbau automatisch auch Veränderungen der explorativ wachsenden Muskeln, Nerven und Blutgefäße zur Folge hat, so daß eine synorganisierte Evolution ablaufen könnte.
„Unsichtbare Anatomie“ (Kompartimentierung). Als drittes grundlegendes Kennzeichen der Lebewesen, das Evolution erleichtern soll, diskutieren die Autoren die sogenannte „unsichtbare Anatomie“. Sie meinen damit die äußerlich nicht erkennbare, aber genetisch feststellbare Kompartimentierung der Lebewesen, die in der Embryonalentwicklung entdeckt wurde. Kompartimentierung in Verbindung mit schwachen Verknüpfungen (weak linkage) ermögliche eine relativ unabhängige Spezialisierung in den verschiedenen Körperregionen und entsprechend auch eine weitgehend unabhängige Evolution (224). Dies habe auch zur Folge, daß Mutationen, die in einem Kompartiment günstig sind, keine negativen Begleiterscheinungen haben müssen, was bei engerer Verflochtenheit wahrscheinlich wäre (203, vgl. 205, 213).
Kritik
Wie entsteht „Evolvability“? Evolutionsfähigkeit und erleichterte Variation sind in die Zukunft gerichtete Fähigkeiten. Selektion ist aber für zukünftige Bedürfnisse blind. Wie, aber auch warum sollten solche Fähigkeiten entstehen, wenn Selektion bestenfalls nur gegenwärtige Bedürfnisse befriedigen kann? Welchen aktuellen Selektionswert hatten die Veränderungen, die zur Evolvierbarkeit führten? Kirschner & Gerhart widmen sich dieser grundlegenden Frage auf zwei Seiten (249-251) im Schlußkapitel ihres Buches, kommen dabei aber über sehr vage Antworten nicht hinaus. Daß die Mechanismen einer erleichterten Evolution aktuell für die Flexibilität der Lebewesen nützlich sind, steht außer Frage, doch ist damit nichts über deren Entstehungswege gesagt. Die Theorie der erleichterten Variation hat gerade an diesem für sie so entscheidenden Punkt offene Fragen.
Weiter muß kritisch nachgefragt werden: Welches Ausmaß an Veränderungen ermöglichen die beschriebenen Eigenschaften „schwache Regulationsverknüpfung“, „exploratives Verhalten“ und „unsichtbare Anatomie“, gemessen an empirischen Befunden? Diese Eigenschaften passen gut in ein Konzept polyvalenter Stammformen von Grundtypen und programmierter Variabilität, aber leisten sie mehr als Mikroevolution? Die von Kirschner & Gerhart genannten experimentell nachvollziehbaren Beispiele von Finkenschnäbeln, Stichlingspanzer und Hämoglobinvarianten sind sehr bescheiden.
Daß die Autoren hierzu mehr versprechen als sie halten können, meinen auch die Rezensenten Charlesworth und Erwin: „Kirschner and Gerhart do not present any detailed examples of how the properties of developmental systems have actually contributed to the evolution of a major evolutionary novelty“ (Charlesworth 2005). „But with its sometimes troubling limitations, the book falls short of the major new theory that the authors promise in their introduction“ (Erwin 2005).
Daß explorative (auf Signale antwortende) Wachstumsvorgänge phylogenetisch nutzbar sein könnten, erscheint als bloße vage Hoffnung. Die Frage ist nämlich: Wie werden auf diesem Wege neue Muskelstränge, neue Ansatzstellen usw. kreiert? Das explorative Verhalten erscheint eher als vorgeplantes Verhalten (s. u.), das den Lebewesen die nötige Flexibilität während der Ontogenese verleiht.
Vergleichend-biologische Argumente statt Mechanismen. Abgesehen von mikroevolutiven Beispielen (s.o.) argumentieren die Autoren im wesentlichen vergleichend-biologisch. Damit ist beispielsweise folgendes gemeint: Die biochemischen Kernprozesse sind bei allen Lebewesen auffallend ähnlich. Daraus wird geschlossen, daß sie früh in der Evolution entstanden sind. Daraus wird weiter auf einen hypothetischen Ur-Vielzeller geschlossen, der Merkmale besaß, die allen heute lebenden Tierstämmen gemeinsam sind. Die Fossilüberlieferung schweigt darüber (58, 196). Oder: Die Unterschiede in den Ontogenesen (Individualentwicklung) und im Erbgut heutiger Arten sollen Auskunft über die evolutiven Abfolgen von Veränderungen im Laufe der Stammesgeschichte geben (237). Vergleichende Studien aber können über Mechanismen der hypothetischen Makroevolution – was Inhalt des Buches sein soll – keine Auskunft geben. Im ganzen Buch wird viel Faszinierendes beschrieben, aber fast nichts bezüglich der Entstehungsmechanismen erklärt.
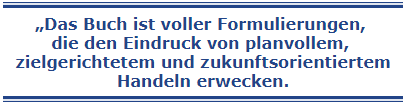
Woher kommen die Kernprozesse und die weiteren Bausteine? Die evolutive Herkunft der sehr konservativen biochemischen Kernprozesse liegt völlig im Dunkeln (50, 55). Kirschner & Gerhart sprechen von „Wellen der Innovation“ (109, 221); sie könnten ohne Informationsverlust ebensogut von „Schöpfung“ sprechen. Bekannt ist die Konstanz dieser Prozesse bei verschiedensten Organismen, ihre Herkunft ist unbekannt.
Aber auch der Ursprung der weiteren Bausteine, auf welche die Mechanismen der erleichterten Evolution zurückgreifen können, wird praktisch nicht thematisiert. Wenn die Autoren z. B. leichte Kombinierbarkeit von Bausteinen ansprechen, die evolutionäre Veränderungen durch neue Kombinationen erleichtere oder ermögliche, bleibt die Frage nach deren Entstehung offen. Aber auch die kombinierenden Mechanismen der biochemischen Kernprozesse und der anatomischen Bausteine sind spekulativ und kein Gegenstand von Experimenten, außer bei peripheren Änderungen (Mikroevolution). Man muß beispielsweise fragen:
Welcher Austausch von Signalen und welche Veränderung in der Kombination wurde jemals experimentell nachgewiesen?
Design: intelligent oder illusionär?
Die Autoren stellen im Vorwort fest, daß die Lebewesen Design zu offenbaren scheinen; nichts gleiche ihnen in der unbelebten Welt. Sie meinen allerdings – in Anspielung auf den berühmten Uhrenvergleich von William Paley – bei den Lebewesen seien im Unterschied zu einer Uhr die einzelnen Komponenten nicht exklusiv nur für einen einzigen, bestimmten Zweck gemacht worden. Vielmehr gebe es bei ihnen vielfachen und unterschiedlichen Gebrauch der Einzelteile und das erleichtere ihre Evolution; das aber fehle in der Technik, weshalb der Vergleich Lebewesen – Technik keinen Analogieschluß bezüglich ihrer Entstehungsweise zulasse.
Doch das ist falsch, denn auch bei technischen Geräten gibt es „vielfache und variable Wiederverwendung derselben Bauelemente“ (7), ja genau das ist sogar typisch für die Vorgehensweise eines planvoll agierenden Konstrukteurs. Der Vergleich Lebewesen – Technik ist in dieser Hinsicht ausgesprochen treffend. Auch wenn sich Kirschner & Gerhart gegen das daraus resultierende „Intelligent Design“-Argument abgrenzen wollen, ihre Darlegungen stützen dieses Argument eindrucksvoll. Die Autoren sprechen selber von „standardisiertem Design“ (111) und vergleichen das mit der Technik.
Überhaupt ist das Buch voller Formulierungen, die den Eindruck von planvollem, zielgerichtetem und zukunftsorientiertem Handeln erwecken, das hinter den faszinierenden variationserzeugenden Mechanismen der Lebewesen steckt. Natürlich wollen die Autoren diesen Eindruck nicht erwecken, aber die von ihnen beschriebenen Mechanismen und die verwendete Sprache drängen den Gedanken einer Zielgerichtetheit an vielen Stellen förmlich auf.
Irreduzible Komplexität. Im Schlußkapitel befassen sich die Autoren auch kurz mit dem Argument der „irreduziblen Komplexität“ (267-269). Behe (1996, 39) bezeichnet ein System als irreduzibel komplex (IC), wenn es notwendigerweise aus mehreren fein aufeinander abgestimmten, interagierenden Teilen besteht, die für eine bestimmte Funktion benötigt werden, so daß die Entfernung eines beliebigen Teils die Funktion restlos zerstört. Darauf aufbauend wird als IC-Argument formuliert, daß es nicht möglich sei, ein IC-System schrittweise durch ungerichtete graduelle Prozesse aufzubauen (vgl. dazu auch den Artikel „Zankapfel Auge“ in dieser Ausgabe). Mit dem Konzept der „schwachen Verknüpfungen“ („weak linkage“) und der Fähigkeit des explorativen Verhaltens soll das Problem der Entstehung von IC-Strukturen lösbar sein. Die Autoren kritisieren am IC-Argument, daß die Natur der Komplexität von Lebewesen nicht beachtet werde (267). Denn bei Lebewesen könnten die Bauteile flexibel auf unterschiedliche Weise zusammengefügt werden und dadurch neue Funktionen erfüllen (s. o.).
Doch damit kann das IC-Argument nicht entkräftet werden. Denn konservierte Kernprozesse und die leichte Möglichkeit des neuen Zusammenbaus werden beim IC-Argument ausdrücklich berücksichtigt. Selbst wenn es für das molekulare Neu-„Zusammenstecken“ von Teilen einen Evolutionsmechanismus gäbe (der experimentelle Nachweis steht aus; es wird vergleichend-biologisch argumentiert, s. o.), wären dennoch mehrere aufeinander abgestimmte Schritte nötig, um neue Funktionen zu erhalten: Genau darin besteht das IC-Argument.
Auch die Fähigkeit des explorativen Verhaltens kann die Entstehung von IC-Strukturen nicht erklären. Denn der Vorgang der Entstehung einer neuen Funktion wird damit nicht beschrieben. So kann man z. B. die Entstehung von Fingern bei den Vierbeinern nicht durch bloße Variation von Knochen und passendes exploratives Verhalten der damit zusammenhängenden Gewebe erklären; dazu werden vielmehr Innovationen benötigt (s.o.).
Exploratives Verhalten als Krönung der Ingenieurskunst. Markus Rammerstorfer (Linz) steuerte in einer persönlichen Mitteilung folgende Überlegung bei: Die Fähigkeit zu explorativem Verhalten bei ontogenetischen Prozessen zeigt: Biologische (Nano-)Technik bedeutet nicht einfach, Strukturen nach einem fixen Bauplan zu realisieren, sondern zeichnet sich durch den Einsatz von (semi-)intelligenten und damit (teil-)selbständigen Einheiten aus. Dies ermöglicht eine sehr effektive und flexible Methode, etwas zu konstruieren. In der Technik werden Maschinen dagegen weitgehend nach exakten Bauplänen gebaut, die jedes Detail ausführen.
Organismen funktionieren dagegen eher wie hochdisziplinierte Armeen. Der Feldherr muß nicht jedem Soldaten einzeln Anweisungen geben, sondern kann sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren. U. U. reicht ein Befehl, um zahlreiche teilselbständige Einheiten sinnvoll in Bewegung zu setzen, die selbst in der Lage sind, kurzfristigere taktische und operative Handlungen zu setzen, die im Sinne des größeren strategischen Konzeptes liegen. Voraussetzung dafür ist eine Steuerinstanz, eine Befehlskette mit Feedbackoption und eine Information für die einzelnen „Einheiten“. Deshalb bilden sich Blutgefäße, Nervensysteme etc. „von selbst“ – ohne Blaupause. Sie kommunizieren vor Ort und entscheiden nach festgelegten Regeln die Details. So gesehen kann man „exploratives Verhalten“ als Krönung der Ingenieurskunst betrachten. Eine solch elegante Konstruktionsmethode funktioniert jedoch nur bei entsprechender Vorprogrammierung. Wie aber entsteht diese? Nochmals im Bild gesprochen: Wie kommt der „Feldherr“ dazu, neue Strategien zu entwickeln und woher bekommt er die dafür speziell ausgebildeten „Soldaten“? Eine Lösung für Makroevolution zeichnet sich hier nicht ab. Es zeigt sich nur, wie somatische Variation auf clever wirkende programmierte Prozesse zurückgeht.
Die Interaktivität organismischer Systeme hat natürlich auch Grenzen. Würde sich hypothetisch z. B. der Hals eines Okapis mutativ verlängern, könnten Muskeln, Nerven, Gefäße automatisch mitwachsen, diese bräuchten wohl kaum gesonderte Anweisungen dafür. Aber ab einer gewissen Höhe macht dann z.B. die Hydrostatik Probleme. Das Gefäßsystem „weiß“ jedoch nicht, daß es deshalb spezielle Rückschlagklappen und ein Wundernetz zu bilden hat, Besonderheiten wie sie bei den Giraffen vorkommen. Das Gefäßsystem bzw. die Zellen, die es bilden, sind nur kompetent, „lokale Probleme“, z.B. die unmittelbare Streckenführung betreffend, zu lösen. Ohne innovative Strategien wird das aber nicht dazu führen, daß neue Strukturen entstehen.
Fazit
„The Plausibility of Life“ ist ein lesenswertes Buch, es bietet viele faszinierende Erkenntnisse aus der Forschung der letzten Jahre. Wie man diese Erkenntnisse im Hinblick auf die Ursprungsfragen interpretiert, ist zu einem gewissen Teil Sache der Perspektive. Kirschner & Gerhart bieten zweifellos interessante Aspekte zur Variations- und Anpassungsfähigkeit der Lebewesen. Daß die von ihnen vorgestellten Befunde mehr hergeben und „Darwins Dilemma“ lösen, kann aus den genannten Gründen jedoch ernsthaft bezweifelt werden.
Literatur
- Behe MJ (1996)
- Darwin’s Black Box: the Biochemical Challenge to Evolution. New York.
- Erwin D (2005)
- A variable look at evolution. Cell 123, 177-179.
- Charlesworth B (2005)
- On the origins of novelty and variation. Science 310, 1619-1620.