Menno Schilthuizen: „Darwin in der Stadt“
Die rasante Evolution der Tiere im GroßstadtdschungelMenno Schilthuizen (2018) Darwin in der Stadt. Die rasante Evolution der Tiere im Großstadtdschungel. München: dtv.
Nachfolgend eine Rezension von Reinhard Junker:
Inhalt
„Rasante Evolution“ in städtischen Lebensräumen
Ein Schöpfungsbuch?
Ein Zebra überquert die Straße auf einem Zebrastreifen – ein geniale Idee für das Cover eines Buches über das Leben von Tieren in der Stadt. Als ich das Buch gesehen habe, dachte ich gleich: Das ist sicher ein interessantes Schöpfungsbuch. Die Lektüre hat mich diesbezüglich nicht enttäuscht. Warum „Schöpfungsbuch“? Der Untertitel gibt einen deutlichen Hinweis: „Die rasante Evolution“. Nach unserem heutigen Wissensstand spricht rasante Evolution dafür, dass bereits programmierte Möglichkeiten abgerufen werden (vgl. Crompton 2019). „Rasant“ heißt im Kontext dieses Buches: innerhalb eines Menschenlebens, in manchen Fällen binnen weniger Generationen der jeweiligen Arten. Denn die städtischen Lebensräume, mit denen sich die tierischen Stadtbewohner arrangieren mussten, existieren in vielen Fällen noch nicht lange. Spezielle Anpassungen, die nur in städtischen Lebensräumen beobachtet werden und andernorts nicht bekannt sind, müssen demnach wahrscheinlich [1] neu entstanden sein. Wie ging das so „rasant“?
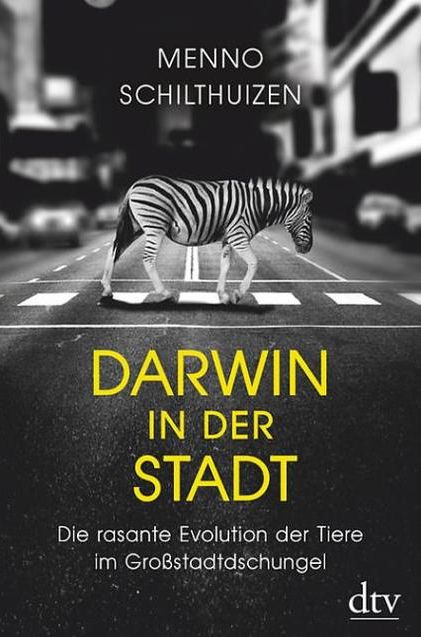 Schnelle Evolution in natürlichen oder naturnahen Verhältnissen wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend beobachtet. Genetische Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass dabei „alte Programme“ abgerufen werden. Für einen Evolutionstheoretiker sind diese „alten“ Programme evolutionär entstanden – wenn auch auf nicht näher bekannte Weise. Aus der Sicht der Schöpfungslehre ist dagegen naheliegend, diese Programme als geschaffen zu interpretieren. Klar ist jedenfalls: Diese Programme sind da. Die Biologen hatten aus evolutionstheoretischer Sicht überhaupt nicht damit gerechnet, dass Evolution derart schnell verlaufen könnte und dass für signifikante Veränderungen nicht Hunderttausende Jahre benötigt werden, sondern bereits wenige Generationen genügen. Man hat „uns beigebracht, dass Evolution ein langsamer Prozess sei …“, schreibt Schilthuizen (S. 13). Die vorherrschende Erwartung langsamer Veränderungen hat mit dem auf Darwin zurückgehenden Evolutionsmechanismus zu tun: Auslese (Selektion) auf der Basis zufälliger Veränderungen, die nur selten für den Organismus günstig sind. Die Ausbreitung und Fixierung neuer Varianten in der Population sind zeitaufwändig. Nun hat sich gezeigt, dass es sehr schnell gehen kann – „rasant“. Schilthuizen meint, Darwin habe die „Kraft seiner eigenen Entdeckung, der natürlichen Selektion, unterschätzt“, was die Geschwindigkeit von Veränderungen betrifft (S. 102).
Schnelle Evolution in natürlichen oder naturnahen Verhältnissen wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend beobachtet. Genetische Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass dabei „alte Programme“ abgerufen werden. Für einen Evolutionstheoretiker sind diese „alten“ Programme evolutionär entstanden – wenn auch auf nicht näher bekannte Weise. Aus der Sicht der Schöpfungslehre ist dagegen naheliegend, diese Programme als geschaffen zu interpretieren. Klar ist jedenfalls: Diese Programme sind da. Die Biologen hatten aus evolutionstheoretischer Sicht überhaupt nicht damit gerechnet, dass Evolution derart schnell verlaufen könnte und dass für signifikante Veränderungen nicht Hunderttausende Jahre benötigt werden, sondern bereits wenige Generationen genügen. Man hat „uns beigebracht, dass Evolution ein langsamer Prozess sei …“, schreibt Schilthuizen (S. 13). Die vorherrschende Erwartung langsamer Veränderungen hat mit dem auf Darwin zurückgehenden Evolutionsmechanismus zu tun: Auslese (Selektion) auf der Basis zufälliger Veränderungen, die nur selten für den Organismus günstig sind. Die Ausbreitung und Fixierung neuer Varianten in der Population sind zeitaufwändig. Nun hat sich gezeigt, dass es sehr schnell gehen kann – „rasant“. Schilthuizen meint, Darwin habe die „Kraft seiner eigenen Entdeckung, der natürlichen Selektion, unterschätzt“, was die Geschwindigkeit von Veränderungen betrifft (S. 102).
Neue Lebensräume für viele Arten
Städte und verbaute Natur verbinden wir eher mit Naturzerstörung als mit Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Schilthuizen lenkt den Blick auf eine andere Sichtweise: Städte bieten eine immens große Anzahl verschiedenster Lebensräume. Eine Millionenstadt sieht er als „aufregendes, neuartiges ökologisches System“ (S. 39). Die Artenzahl ist erstaunlich hoch, manchmal sogar höher als im ländlichen Umland. In manchen Städten ist ein nennenswerter Anteil der eingewanderten Arten exotisch und stammt aus verschiedenartigen Ursprungsregionen in aller Welt (S. 74). Tiere, die in städtischer Umgebung heimisch werden, bringen gewisse Voranpassungen mit (Kapitel 6). Beispielsweise mögen Vögel in den Städten von Hause aus felsigen oder wüsten Untergrund, sie teilen unsere Vorlieben bezüglich Ernährung oder sie sind ganz einfach bezüglich ihrer Lebensumstände nicht besonders wählerisch. Es ist spannend zu verfolgen, welche Arten sich mit den neu entstandenen Lebensräumen anfreunden, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, den angestammten Lebensraum mit der städtischen Umgebung einzutauschen. Der Autor beschreibt in kurzweiliger Darstellung viele solcher Beispiele.
Eines der interessantesten Beispiele wird im Prolog geschildert: die Londoner U-Bahn-Stechmücke Culex pipiens molestus, die im Tunnelsystem des Londoner U-Bahn-Netzes ihr Dasein fristet. Während oberirdische Stechmücken das Blut von Vögeln saugen, bedient sich die U-Bahn-Stechmücke bei Pendlern und legt ihre Eier in Wasser, das in Vertiefungen und Hohlräumen vorkommt. Später wurde sie in anderen menschengemachten Lebensräumen entdeckt. Untersuchungen des Erbguts verschiedener U-Bahn-Populationen zeigten, dass sie sich genetisch von der oberirdischen Form unterscheiden. Proteine in Fühlern sind verändert, so dass die Mücken „auf menschliche Ausdünstungen anstelle von Vogelgerüchen reagieren“ (S. 13). Gene, die die innere Uhr beeinflussen, sind verändert oder abgeschaltet – im Dunkeln wird die innere Uhr nicht benötigt. Das Sexualverhalten hat sich ebenfalls verändert – statt Paarungen in großen Schwärmen nunmehr bei Begegnungen von Einzeltieren. Welches Ausmaß und Qualität an Änderungen des Erbguts für diese Veränderungen im Verhalten notwendig waren, wird nicht näher geschildert, aber es ist klar, dass eine so schnelle Anpassung nur auf der Basis bereits vorhandener Möglichkeiten erfolgen kann.
Eine solche möglicherweise programmierte Veränderung kann z. B. durch Transposons erfolgen – springende Genabschnitte, die an neuen Stellen im Erbgut eingebaut werden können. Das berühmte Beispiel der hell und dunkel gefärbten Birkenspanner ist durch einen einzelnen Sprung eines Transposons zu erklären; der „erste aktenkundige Fall urbaner Evolution“ (S. 121). In anderen Fällen haben offenbar punktuelle Veränderungen (sog. Punktmutationen) zu Anpassungen geführt.
In Auswahl seien einige weitere Beispiele genannt: So wurden Veränderung von Federlänge und Flügelform bei Fahlstirnschwalben beobachtet; sie ermöglichen größere Wendigkeit (S. 130). Manche Fische wie der Blaubandkärpfling (auch Killifisch genannt) werden mit chemischem Abfall fertig (S. 156; vgl. Junker 2017). Dessen Anpassung an die Wasserverschmutzung erfolgte durch Verlustmutationen in Genen für ein Empfängerprotein von Signalmolekülen innerhalb weniger Dutzend Generationen (S. 159). Bei lichtliebenden Insekten wurde Evolution hin zur Resistenz gegen Anlockung durch Licht beobachtet (Kapitel 12). Weitere Beispiele sind Verhaltensänderungen bei Vögeln (Kapitel 15): Stadtvögel haben z. B. gelernt, den Aluminiumverschluss von Milchflaschen zu öffnen, sie zeigen eine bessere Problemlösefähigkeit, größere Neugier und Wagemut (S. 224). Auch dafür wurden teilweise genetische Veränderungen gefunden. Oder es wurden Änderungen von Vorlieben der Weibchen für bestimmte Gefiedermerkmale der Männchen beobachtet (sexuelle Selektion, Kapitel 17). In der Stadt gibt es wegen der besonderen Lebensbedingungen andere Anforderungen an die Männchen für Brutpflege im Vergleich zu den natürlichen Standorten, was ebenfalls die Vorlieben der Weibchen für bestimmte Merkmale der Männchen beeinflusst. Die damit einhergehenden Verhaltensänderungen könnten zur Artbildung führen (S. 159).
Auch Beispiele aus der Pflanzenwelt werden beschrieben: So besitzt der Belgische Pippau (Crepis sancta, ein Kornblütler) zwei Sorten von Samen: leichte und mit Härchen versehene bzw. schwere ohne Härchen. In Stadtbiotopen mit eingeschränkten Verbreitungsmöglichkeiten durch den Wind sind letztere bevorzugt und werden eher angetroffen. Die Situation ist hier ähnlich wie bei Pflanzen, die auf kleinen Inseln vorkommen. So sind auch beim Gewöhnlichen Ferkelkraut (Hypochoeris radicata) auf Inseln die Samen schwerer und die Härchen kürzer (S. 131f.).
Wie sind Ausmaß und Qualität der Veränderungen der Tiere und Pflanzen in städtischen Lebensräumen zu bewerten?
Schilthuizen schreibt dazu: „Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen … reden wir ja nicht über die Entwicklung völlig neuer Lebensformen“ (183). Welche Ausnahmen der Autor meint, ist allerdings unklar. Nur bei der Erforschung von Veränderungen bei Stadtamseln gegenüber Waldamseln sieht er „stichhaltige Beweise für das Auftreten evolutionärer Neuheiten, angepasst an die Lebensbedingungen in der Stadt“ (S. 270). Allerdings definiert er nicht, was er unter einer „evolutionären Neuheit“ versteht. Die von Schilthuizen beschriebenen Veränderungen der Stadtamseln beinhalten jedenfalls keine Neuheiten: Änderungen in der Ernährung und damit einhergehend der Schnabelform, was auch zu Änderungen im Gesang führe, hormonale Änderungen, Anpassung der biologischen Uhr, Fluchtverhalten und frühere Brutzeit und dadurch Fortpflanzungsisolation von Stadtamseln, was als beginnende oder sogar bereits etablierte Artbildung angesehen werden kann (S. 270). Allerdings erfordert auch die Artbildung nicht die Etablierung evolutionärer Neuheiten, sondern ist eher ein Prozess einer unterschiedlichen Spezialisierung.
Genetische Änderungen oder Plastizität? In vielen Fällen konnten bei den Stadtbewohnern genetische Änderungen gegenüber der Ursprungspopulation nachgewiesen werden, zum Beispiel bei den Stadtamseln oder bei den Stechmücken. Schilthuizen diskutiert in Kapitel 13 aber auch die Möglichkeit, dass Anpassungen an die Verhältnisse in der Stadt Ausdruck nicht-erblicher Plastizität sein können. Damit ist gemeint, dass Umweltreize eine Merkmalsvariation bewirken oder schlummernde Programme „einschalten“ können. Ein bekanntes Beispiel für eine plastische Reaktion ist die Verdickung der Hornhaut durch fortgesetzte mechanische Beanspruchung. Der Autor schreibt: „Überdies müssen die kleinen genetischen Besonderheiten, die erforderlich sind, damit es zur urbanen Evolution kommen kann, oft nicht erst geschaffen werden, sondern sind schon gegeben“ (S. 183f.) und nennt als Beispiel die Gefiederfärbung von Tauben. Als weitere Quelle von Anpassungsmöglichkeiten, die nicht neu evolvieren müssen, nennt er den Gen-Polymorphismus. Das bedeutet, dass die meisten Arten von Natur aus genetisch variabel sind (S. 184) und von den betreffenden Genen in der Population verschiedene Varianten vorliegen. Solche Varianten desselben Gens nennt man Allele und spricht von mehrfacher (multipler) Allelie. Diese sei das „evolutionäre Kapital jeder Spezies“ (S. 185). In diesen Fällen brauchen die Tiere und Pflanzen „nicht darauf zu warten, bis der Zufall ihnen eine günstige Mutation beschert“ (S. 185). Tatsächlich ist dieses Kapitel aber nicht notwendigerweise evolutionär; es ist einfach vorhanden und könnte genauso gut als Schöpfungskapital interpretiert werden.
Schließlich sind auch epigenetische Faktoren zu beachten (S. 190). Schilthuizen zitiert dazu einen Kollegen: „Fast keine der bisher vorgelegten Studien zur urbanen Evolution habe den Unterschied zwischen genetisch bedingter Anpassung und epigenetischen Effekten berücksichtigt, …“ (191). Unter Epigenetik werden Faktoren und Prozesse zusammengefasst, die gleichsam von außen auf die Gene regulierend einwirken. Diese Faktoren lassen das Erbgut selbst unverändert. Sie sind jedoch nicht dauerhaft vererbbar und daher ohne nennenswerte Bedeutung für die Evolution.
Fazit
Schilthuizen schreibt: „Für Darwin war die Evolution ein langsamer Vorgang, der in einem einzelnen Menschenleben nicht wahrzunehmen war. Dieses eine Mal lag er falsch“ (S. 97). Unter geeigneten Bedingungen können Veränderungen auch „rasant“ erfolgen. Die große Geschwindigkeit, mit der die Veränderungen erfolgen, ist aber nur möglich, wenn die Anpassungen bereits angelegt oder in irgendeiner Weise programmiert sind. Die in diesem Buch geschilderten Beispiele bewegen sich in einem insgesamt engen gestaltlichen, physiologischen und verhaltensbiologischen Rahmen und können nicht als Belege für die Entstehung evolutionärer Neuheiten gewertet werden. Soweit die zugrundeliegenden molekulargenetischen Prozesse aufgeklärt sind, liegen ebenfalls keine Neuheiten vor, sondern sie beruhen auf Mutationen, Gen-Polymorphismus, Plastizität oder Epigenetik, mithin auf einem Potenzial, das als Ausdruck angelegter Möglichkeiten interpretiert werden kann.
Dass so viele Lebewesen sich derart vielfältig auf neue Lebensräume einstellen können, ist nicht selbstverständlich. Die Tiere und Pflanzen bringen offenbar eine so große Anpassungsfähigkeit mit, dass sie sich mit Bedingungen arrangieren können, mit denen ihre Art zuvor gar nicht konfrontiert war. Aus der Sicht der Schöpfungslehre kann man diese Fähigkeit als Ausdruck weiser Vorausschau des Schöpfers interpretieren.
Anmerkung
[1] Eine Alternative wäre Einwanderung und Selektion passender Formen. Genetische Studien unterstützen diese Alternative allerdings nicht.
Literatur
Crompton N (2019) Mendel’sche Artbildung und die Entstehung der Arten. Internetartikel.
Junker R (2017) Programmierte Anpassungsfähigkeit bei Killifischen? Stud. Integr. J. 24, 53-54.