0.5 Theologie, Biblische Apologetik
0.5.1.1 Biblische Gründe für eine theistische Evolution?
In der Theologie hat sich die Sicht eingebürgert, die Evolution der Lebewesen als Vorgang der Schöpfung zu interpretieren („theistische Evolution“). Dafür werden biblische und außerbiblische Begründungen vorgebracht. Diese erweisen sich aber als nicht stichhaltig und sind darüber hinaus teilweise recht fragwürdig.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel werden einige Begründungen vorgestellt, die für das Konzept einer „theistischen Evolution“ (Schöpfung durch Evolution) formuliert wurden. Die einzelnen Argumente werden einer kritischen Bewertung unterzogen.
1.1 Was ist „theistische Evolution“?
Der Begriff „theistische Evolution“ steht für „theistisch interpretierte Evolutionsauffassung“. Gemeint sind damit Sichtweisen, wonach Gott in irgendeiner Weise mittels Evolution die Lebewesen erschuf, auch den Menschen. Im einzelnen gibt es darüber verschiedene Vorstellungen, so die Auffassung, dass Gott in den Evolutionsprozess eingegriffen und ihn dadurch gelenkt habe, oder die Vorstellung, dass Gott die Materie „evolutionsfähig“ geschaffen habe, und andere. Allen diesen Konzepten gemeinsam ist, dass eine allgemeine Evolution der Lebewesen, die einige Milliarden Jahre gedauert hat, zugrundegelegt wird. Hierin besteht also kein Unterschied zu einer rein naturwissenschaftlichen Betrachtung. Das Spezifikum einer „theistischen Evolution“ ist die Hinzunahme des Schöpfungsgedankens zum Evolutionsvorgang. Wie man sich eine solche Zusammenschau konkret vorstellen soll, darüber wird von den Vertretern dieser Sichtweise keine oder nur eine sehr vage Auskunft gegeben. Das soll hier daher auch nicht thematisiert werden.
In der akademischen Theologie und in der Religionspädagogik wird heute in der Regel die Sicht vertreten, dass die Bibel weder positiv noch negativ zum Evolutionsgedanken stehe. Darin ist die Auffassung eingeschlossen, dass die Evolutionsanschauung nicht im Widerspruch zur Schöpfungslehre stünde. Das biblische Schöpfungszeugnis lasse die Vorstellung einer allgemeinen Evolution der Lebewesen zu.
Einige Autoren finden den Evolutionsgedanken in der Bibel sogar vorgebildet und meinen, es gebe ausdrückliche Hinweise in der Bibel auf Evolution. In diesem Artikel werden einige Argumente zusammengestellt, die nach Ansicht von Vertretern einer theistischen Evolution belegen sollen, dass das biblische Zeugnis eine solche Sichtweise zulässt oder sogar gegenüber anderen Vorstellungen favorisiert. Diese Begründungen werden jeweils kritisch hinterfragt.
1.2 Die „Tatsache“ der Evolution
Eine häufig vorgebrachte Begründung für die Akzeptanz der Evolutionslehre in der Theologie ist der Hinweis, dass die Evolutionsanschauung naturwissenschaftlich ausgesprochen plausibel sei. Zweifel daran seien heute nicht mehr möglich. Es gehöre zur intellektuellen Redlichkeit, im evolutionären Deutungsrahmen zu denken.
Kritik: Eine allgemeine Evolution der Lebewesen kann nicht als Tatsache gelten, an welche man sich im Denken binden müsse. Dies gilt schon aus grundsätzlichen Erwägungen: die Ursprünge können nicht unmittelbar erforscht werden; darüber können nur mehr oder weniger plausible Szenarien entwickelt werden (|1.1.3.2.1 Methodik der historischen Forschung|). Darüber gibt es zum einen keine zwingenden Belege für Evolution, zum anderen sind grundlegende Fragen im Rahmen des Evolutionsmodells ungelöst (wie in Genesisnet in den entsprechenden Artikeln gezeigt wird).
1.3 Religionsgeschichtliche Argumente
Im Zuge der Bibelkritik hat sich weithin die Sicht eingebürgert, dass die Berichte in Genesis 1,11, wie sie in der Heiligen Schrift heute gegeben sind, Ergebnisse eines längeren Nachdenkens über den Gott Israels seien. Für viele Ausleger ist frühestens mit dem Auszug aus Ägypten historisch tragfähiger Grund gegeben. Vom Erleben der Befreiung ausgehend, habe Israel in späteren Reflexionen Aussagen auch über das Schöpfungs- und Gerichtshandeln Gottes formuliert.
Mit diesem Verständnis ist gewöhnlich die Auffassung gekoppelt, die ersten Kapitel der Bibel seien insofern historisch irrelevant, als sie nicht zur Rekonstruktion der globalen Geschichte (z. B. Sintflut) herangezogen werden können.
Wird die biblische Urgeschichte nicht als Schilderung tatsächlicher Geschehnisse gewertet, stellt sich die Frage nach der wirklichen Geschichte. Hier steht nur die Evolutionsanschauung als Alternative zur Verfügung.
Beispielhaft soll die Argumentation Lanzenbergers (1988) angeführt und beurteilt werden. Nach seiner Auffassung stehen Schöpfung und Entwicklung nicht im Widerspruch zueinander, weil sogar die Autoren von Genesis 1 und 2 „in weiser Voraussicht zwei Weltsichten, die nicht mit gleichem Maß zu messen sind, nebeneinander zu Worte kommen“ ließen. „Die biblischen Autoren denken tiefsinnig und ganzheitlich und schließen sich naturwissenschaftlichen Denkweisen auf, wogegen sich unser historisches Denken, das Schöpfung und Evolution spaltet, als ein gewaltiger Rückschritt erweist. Darum nenne ich die Alternative ‘Schöpfung gegen Evolution’ ganz provokativ unbiblisch.“
Zur Begründung verweist dieser Autor allerdings lediglich auf Gerhard von Rad, nach dessen Einschätzung theologisches und naturwissenschaftliches Erkennen im Schöpfungsbericht spannungslos ineinander ruhen (vgl. dazu aber |0.2.1.1 Die biblische Urgeschichte – wirkliche Geschichte|). Freilich sei die Naturerkenntnis entsprechend den Einsichten der damaligen Zeit ausformuliert. Ebenso sollen wir die heutige naturwissenschaftliche Sicht in die Auslegung der Schöpfungsgeschichte einbeziehen, und das ist die Evolutionsanschauung.
Kritik: Eine schlüssige Begründung müsste an dieser Stelle den Nachweis liefern, dass der Ersatz der im Schöpfungsbericht enthaltenen vermeintlich altertümlichen naturwissenschaftlichen Vorstellungen durch das moderne (evolutionistische) Weltbild am Aussageinhalt nichts ändert. Dies ist nicht der Fall, wie in |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament| gezeigt wird.
1.4 Überlegungen zum Gottesbild
Zahlreichen Autoren erscheint Gott größer und genialer, wenn die von ihm geschaffene Welt sich selbständig und selbsttätig entwickelt habe. Die Allmacht Gottes zeige sich deutlicher, wenn sie mittelbare Ursachen in ihren (evolutiven) Dienst stelle und trotzdem alles planmäßig erreiche. Auch zeige sich die Vorsehung Gottes als weitschauender und planvoller, wenn man eine evolutive Welt unterstelle.
Kritik: Diese Argumentation ist ausgesprochen subjektiv. Aus christlicher Sicht stellt sich die Frage, was die Bibel über Gottes Schöpfungshandeln sagt. Was wir darüber denken ist nicht von Bedeutung. Es ist zudem nicht einsichtig, weshalb sich in einem Erschaffen mittels geschöpflicher Wirkungen Gottes Macht deutlicher zeigen soll.
Außerdem steht diesen Einschätzungen die Destruktivität der Schöpfungsmethode durch Evolution entgegen (vgl. |0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode?|). Denn Evolution als Schöpfungsmethode beruht auf einem Überschuss an Tod von Individuen und Arten mit den dazugehörenden Begleitphänomenen.
Im Übrigen schließt auch das Konzept einer direkten Erschaffung nicht aus, dass bei diesem Vorgang die Schöpfungswerke vielfältig beteiligt sind. Die Frage ist nicht, in welchem Konzept die Geschöpfe überhaupt beteiligt sind, sondern wie sie beteiligt sind.
Als weiteres Argument wird häufig angeführt, Gottes schöpferisches Tun sei nicht nur etwas, was einmal in der Vergangenheit stattgefunden habe, sondern was in der Gegenwart andauere und in die Zukunft hineinrage; es sei nicht nur auf den Anfang beschränkt. Auch dies könne gerade durch eine Evolutionsanschauung veranschaulicht und plausibel gemacht werden.
Ein beständiges Wirken Gottes kann allerdings auch in einer nicht-evolutionären Welt plausibel gemacht werden. Die Welt braucht Gottes Gegenwart, um Bestand zu haben. Man könnte sich denken, dass die Welt ohne Gottes beständiges Erhaltungshandeln ins Nichts zurückfallen würde. Wird eine besondere Schöpfung (creatio specialis, creatio originalis) am Anfang angenommen, so beinhaltet dies kein Zurückziehen Gottes von der Welt, nachdem sie ins Dasein gebracht wurde.
Die Identifizierung von Schöpfungs- und Erhaltungshandeln ist im Übrigen problematisch, weil die heutige Welt eine Welt der Sünde ist. In dieser Welt geschehen Dinge, die nicht dem Willen Gottes gemäß sind. Die Tatsache, dass sie dennoch unter seiner Kontrolle sind, ist am besten durch den Begriff der „Erhaltung“ (creatio continua et servanda) zu fassen. Den Begriff „Schöpfung“ für das Erhaltungshandeln zu verwenden, würde eine Billigung des heutigen Zustandes suggerieren, die so nicht gegeben ist. Das besondere schöpferische Wirken Jesu Christi wird von Jesus selber wie von den neutestamentlichen Zeugen nicht als Bestätigung des Gegenwartszustandes, sondern als Einspruch gegen ihn, als Zeichen des Hereinbrechens der eschatologischen [= zukünftigen, im Sinne von Gottes souveränem Handeln] Schöpfung gewertet.
1.5 Vergleich zwischen Stammesgeschichte und Individualentwicklung
Dass nach dem biblischen Gesamtzeugnis evolutives Werden und Schöpfungshandeln Gottes nicht gegensätzlich zu sehen sind, wird oft (z. B. mit Verweis auf Psalm 139) damit begründet, dass der Gläubige sich selbst als Schöpfung Gottes versteht. Derselbe Vorgang, der biologisch gesehen eine Entwicklung sei, sei aus Gottes Perspektive eine Schöpfung. So argumentiert Hemminger (1988): „Warum sollte der Gott, der Brot schafft, indem er Weizen wachsen lässt, nicht Tiere und Pflanzen geschaffen haben, indem er sie aus einfacheren Vorformen wachsen ließ? . . . Wir wissen mit Sicherheit, dass Gott langsam und auf teilweise verstehbaren Wegen Dinge schafft, die ihm unendlich wichtig sind: menschliche Persönlichkeiten.“ Hemminger begründet diese Argumentation damit, dass wir im täglichen Leben hinter natürlichen Vorgängen oder günstigen Fügungen von an sich rein „natürlichen“ Ereignissen Gottes Handeln erkennen (z. B. auf Gebete hin). Es werden also Parallelen zwischen der Ontogenese [= individuelle Entwicklung von Organismen] und Vorgängen im Alltagsbereich einerseits und einer gedachten Phylogenese [= Abstammung aller Lebewesen von einfacher gebauten Vorformen] andererseits hervorgehoben.
Kritik: Es ist zwar richtig, dass Gott auch in natürlichen Prozessen am Werke ist. Dennoch sind die genannten Vergleiche und die mit ihnen bezweckte Begründung der Möglichkeit einer theistischen Evolution irreführend. Dies wird deutlich, wenn einige Punkte zusammengestellt werden, in denen Ontogenese und Phylogenese einander nicht entsprechen:
- Die Ontogenese ist im Gegensatz zur postulierten Phylogenese ein zielgerichteter Vorgang. Bei der Ontogenese steht zu Beginn fest, was ihr Ergebnis bei ungestörtem Verlauf sein wird. Mit der Befruchtung sind die wesentlichen Entscheidungen gefallen (geeignete Rahmenbedingungen für die Ontogenese vorausgesetzt). In der hypothetischen Phylogenese eine Zielgerichtetheit sehen zu wollen, ist bloßes theologisches oder philosophisches Postulat [= Forderung], das durch die bekannten Daten in keiner Weise gestützt wird. Die meisten Evolutionstheoretiker bestreiten eine Zielgerichtetheit des Evolutionsprozesses ausdrücklich.
- Der Weg zum Ziel verläuft ganz unterschiedlich. Während für eine postulierte Phylogenese nur das Prinzip „Versuch und Irrtum“ gilt und Auslese der Bestangepassten erfolgt, ist die Ontogenese ein Prozess, bei dem einzelne Stadien folgerichtig und zielgerecht nacheinander ablaufen. Die phylogenetische Entwicklung soll dagegen auf Kosten einer immensen Zahl zu wenig angepasster Individuen und von millionenfachem Artentod (Aussterben) voranschreiten. Ein von Gott gelenkter Prozess einer allgemeinen Evolution würde bedeuten, dass der Schöpfer diesen Prozess in ein zahlloses Sterben und Aussterben führt. In der Ontogenese gibt es diesen Aspekt des Aussterbens ebensowenig wie den der Auslese der Überlebenstüchtigsten. Für den harmonischen ontogenetischen Verlauf gibt es keine Entsprechung in der Stammesgeschichte.
- Die ontogenetische Entwicklung beginnt im Besitz der vollständigen genetischen Information, die zum Aufbau des erwachsenen Individuums erforderlich ist (als notwendige, wenn auch nicht ausreichende Voraussetzung der Entwicklung). Diese Voraussetzung ist in der stammesgeschichtlichen Entwicklung nicht gegeben; diese startet in dieser Hinsicht praktisch mit nichts. Während der Ontogenese entwickelt sich eine vorausgesetzte Ganzheit, eine gedachte Stammesgeschichte dagegen wäre gar keine „Entwicklung“ im üblichen Wortsinn, denn sie verläuft ohne vorgegebene, prägende Information. Zu Beginn der Ontogenese liegt also ein lebendiger Organismus als Ganzheit vor. Die postulierte Stammesgeschichte vom Einzeller zum Menschen ist völlig verschieden von der Ontogenese, die mit einem menschlichen Organismus (in Form einer befruchteten Eizelle) bereits beginnt. Auf den Menschen konkretisiert heißt das: In der Ontogenese entwickelt sich der Mensch als Mensch von Anfang an. In der Stammesgeschichte soll sich dagegen ein Einzeller unter anderem zum Menschen hin entwickelt haben.
Theologisch bedeutsam ist vor allem Punkt 2: Der Vergleich Ontogenese-Phylogenese kann nicht konsequent durchgeführt werden, da die Entwicklungsweisen ganz unterschiedlich wären, also im Konzept einer „theistischen Evolution“ verschiedene Schöpfungsmethoden bei Stammesgeschichte und Individualgeschichte vorliegen würden. Das heißt: Das Schaffen Gottes durch ontogenetische Entwicklung wäre von Grund auf verschieden von einem Schaffen durch phylogenetische Entwicklung. Der Vergleich zwischen Ontogenese und Phylogenese ist daher irreführend, da – insbesondere dem biologisch Unkundigen – eine falsche Vorstellung eines „evolutiven Erschaffens“ suggeriert wird. Man denkt sich die unanschauliche und faktisch nicht evidente Phylogenese fälschlicherweise wie die anschauliche ontogenetische Entwicklung.
Wichtig ist auch Punkt 3: Die eigentliche Erschaffung des individuellen Menschen geschieht nicht während seiner Individualentwicklung oder an deren Ende (wie in der postulierten Stammesgeschichte), sondern am Beginn. Dabei bleibt es freilich Gottes Geheimnis, wie aus Ei- und Samenzelle ein neuer Mensch, ein neuer verwirklichter Gedanke Gottes wird. Jedenfalls ist mit der befruchteten Eizelle ein neuer Mensch in Existenz, der nicht erst im Laufe der Embryonalentwicklung zum Menschen wird. Daher kann die Embryologie keinen Einschnitt in der menschlichen Ontogenese feststellen, der einen Übergang vom „Noch-nicht-Menschen“ zum Menschen belegen würde.
Schlussfolgerung: Die Unterschiede zwischen individueller und stammesgeschichtlicher Entwicklung sind so grundlegend, dass eine besondere Begründung erforderlich ist, wenn in beiden Fällen ein vergleichbares Schöpfungshandeln Gottes gesehen wird. Auch wenn ein Entwicklungsprozess prinzipiell als Wirken Gottes verstanden werden kann (wie in der Ontogenese), muss doch eigens begründet werden, weshalb die Art und Weise einer gedachten stammesgeschichtlichen Entwicklung mit dem biblisch bezeugten Schöpfungshandeln Gottes vereinbart werden kann. Angesichts der grundlegenden Verschiedenartigkeit beider Prozesse wäre ein sich darin ausdrückendes Schöpfungshandeln ganz verschieden geartet.
1.6 Verschiedene Argumente
Neben diesen allgemeinen Gesichtspunkten, die die Möglichkeit theistisch-evolutionärer Konzepte begründen sollen, werden auch einzelne biblische Texte angeführt. Manche Autoren weisen darauf hin, dass die biblischen Autoren nicht nur von einem „geschaffen“, sondern auch von einem „geworden“ sprechen. Was nun in der sichtbaren Wirklichkeit als ein Ablauf erscheint (Evolution), ist in der unsichtbaren Wirklichkeit ein Gesetztsein (Schöpfung). Derselbe Prozess des Werdens der Welt sei ein Setzen, ein Schaffen Gottes. Die biblischen Schriftsteller verwendeten das hebräische Wort für Gottes unvergleichliches Schaffen („bara“) auch für Vorgänge, die eindeutig auch den Aspekt des Werdens zeigen: So ist das Volk Gottes „geschaffen“ (bara; Jes 43,1). Daher könne man auch annehmen, dass der Mensch gleichzeitig evolutiv geworden und geschaffen sei.
Des weiteren wird oft darauf verwiesen, dass nicht überall im Schöpfungsbericht von einem besonderen Schöpfungsakt Gottes die Rede sei, sondern auch davon, dass die Erde sprossen lassen (Gen 1,1112), das Wasser wimmeln (1,20) und die Erde hervorbringen (1,24) solle. Die Erschaffung der Pflanzen und Tiere schließe also die (evolutive) Entwicklung der Arten ein. Dieses Element der Evolutionstheorie sei damit schon andeutend vorweggenommen.
Lanzenberger (1988) interpretiert das göttliche „Es werde“ im Sinne eines evolutiven Werdens und Wirkens. Das hebräische Wort enthalte sachlich das, was wir heute mit Evolution umschreiben.
Einen weiteren Beleg für den impliziten Evolutionsgedanken sieht Lanzenberger in den „Toledot“ („das ist die Geschichte von …“), die er mit „Evolutionsgeschichte“ übersetzt.
Das Wort „Segen“ soll nach diesem Autor ebenfalls den Evolutionsgedanken nahelegen. Es bedeute Gottes Lebenskraft für alle „lebenden Seelen“ und zeige deutlich, „dass Gott keine übernatürliche Schöpfung vorhatte, die alles Leben irgendwann vom Himmel fallen ließ. Gott hat eine Welt erschaffen, die Spielraum zur Entwicklung enthält, damit gibt Gott seinen Geschöpfen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Segen bedeutet somit die Bereitstellung und Gabe zur Lebensentwicklung seiner Geschöpfe.“ Segen enthalte den Auftrag zur Evolution.
Öfter wird auch auf Psalm 104 verwiesen, wo u. a. von einem Werden und Vergehen der Tiere die Rede ist. Dies wird oft im Sinne einer Vereinbarkeit mit der Evolutionslehre gedeutet. In diesem Zusammenhang wird gelegentlich auch Pred 3,19 erwähnt, wonach der Mensch wie das Vieh stirbt, beide den gleichen Odem haben und der Mensch dem Vieh nichts voraus hat.
Schließlich wird auf Röm 8,1922 Bezug genommen. Hemminger & Hemminger (1991) meinen, Paulus spreche hier von der Schöpfung, als sei sie noch nicht fertig.
Die stammesgeschichtliche Verbundenheit zwischen Tieren und dem Menschen wird auch darin gesehen, dass Mensch und Tier gleichermaßen als „Seele“ (hebr. näphäsch) bezeichnet werden.
Kritik: Der Überblick über die vorgetragenen Argumente zeigt, dass der biblischen Überlieferung keine offenkundig positiven Belege für eine evolutive Geschichtsdeutung entnommen werden können. Biblische Texte können die Akzeptanz einer Evolutionslehre weder begründen noch nahelegen. Vielmehr wird hier der Evolutionsgedanke in die Texte hineingelesen. Manche Textstellen können wohl isoliert betrachtet mit dem Evolutionsgedanken harmonisiert werden, legen ihn aber nicht nahe. Die Begriffe und Wendungen „Toledot“, „Segen“, „es werde“, „lasse sprossen, wimmeln, bringe hervor“ legen in keiner Weise Evolution im stammesgeschichtlichen Sinne nahe. Ps 104 und Pred 3 schildern nicht die ursprüngliche, sondern die gefallene Schöpfung. Ebenso geht es in Röm 8,19ff. um ein geschichtliches „Unterworfenwerden“ der Schöpfung (ausführliche Begründung im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|). Die Tatsache, dass Israels Werden als Schöpfung Gottes interpretiert wird, kann nicht auf das Entstehen der Organismen übertragen werden. Die geschöpfliche Verbundenheit von Mensch und Tier besagt nichts über ihre Entstehungsweise. Zudem ist nur der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen.
Die vorgebrachten Argumente stellen auch das realhistorische Verständnis von Genesis 1-11 nicht in Frage.
Literaturhinweise: Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.
Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004.
Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.
(Infos zu diesen Büchern: https://www.wort-und-wissen.org/shop/)
1.7 Zitierte Literatur
Hemminger H (1988) Kreationismus zwischen Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft. Orientierungen und Berichte.
Hemminger H & Hemminger W (1991) Jenseits der Weltbilder. Stuttgart.
Lanzenberger G (1988) Schöpfung ist Evolution. Karlsruhe.
Autor: Reinhard Junker, 24.01.2022
© 2022, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/e2021.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament (Interessierte)
Die Evolutionslehre scheint auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang mit Aussagen des Neuen Testaments zu stehen. Tatsächlich sind aber das Kommen, das Leiden und Sterben Jesu nur vor dem Hintergrund des Sündenfalls des Menschen zu verstehen, durch den der Tod in die Welt kam. In evolutionstheoretischer Sicht gibt es einen solchen Einschnitt jedoch nicht. Das Kommen und Wirken Jesu passt daher nicht in das Geschichtsbild der Evolution.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird gezeigt, welche Folgen die Akzeptanz einer evolutiven Abstammung des Menschen aus dem Tierreich für das Verständnis des Neuen Testaments und seiner Botschaft von Jesus Christus hat
1.1 Einleitung
In der gegenwärtigen Theologie wird die Evolutionslehre weitgehend akzeptiert. Sie betreffe die Inhalte des christlichen Glaubens nicht. Nach verbreiteter Auffassung könne die Theologie den Naturwissenschaften das „Wie“ der Schöpfung überlassen; dem christlichen Zeugnis sei nur das „Dass“ wichtig. Die biblischen Aussagen über „Schöpfung“ könne man auch vertreten, wenn man von einer allgemeinen Evolution ausgeht. Doch das trifft in Wirklichkeit keineswegs zu. Um dies nachvollziehen zu können, werden zunächst wichtigsten Inhalte der Evolutionslehre (das „Wie“) zusammengestellt.
1.2 Unverzichtbare Inhalte aller Evolutionstheorien
Zu den notwendigen Voraussetzungen für Evolution, ohne die eine Evolution (auch eine theistische, d. h. von Gott gelenkte oder initiierte Evolution) nicht stattfinden kann, gehören u. a.:
- Alle Organismen sind in einem einzigen Stammbaum verbunden, an dessen Wurzel einzellige Organismen stehen.
- Der Artenwandel vollzieht sich in Populationen [= in Fortpflanzung miteinander stehende Angehörige derselben Art], d. h. es genügt nicht die Änderung einzelner Tiere oder Pflanzen, sondern die Arten müssen sich als ganze ändern. Insbesondere gibt es kein erstes Menschenpaar (Abb. 138).
- Die bekannten Mechanismen der Evolution sind für den Veränderungsprozess (vielleicht nicht ausschließlich, aber doch notwendig) erforderlich (Abb. 139).
- Ohne den individuellen Tod und ohne den Artentod (Aussterben) gibt es keine Evolution.
- Nicht nur Körpermerkmale, sondern auch Verhaltensweisen sind aus den Gesetzmäßigkeiten der Evolution (mindestens teilweise) zu erklären (vgl. Abb. 140).
- Die Menschheitsgeschichte ist am äußersten zeitlichen Rand der Kosmosgeschichte angesiedelt.

Abb. 138: Solche Bilder von „Affenmenschen“ beinhalten zwar mehr Phantasie als Realität, dennoch gehören solche Vorstellungen zur Theorie einer Abstammung des Menschen aus dem Tierreich.

Abb. 139: Einer schlägt den anderen: das ist eine der wichtigsten Triebfedern evolutionärer Entwicklungen. Schöpfung durch Evolution heißt Schöpfung durch Kampf ums Dasein.

Abb. 140: Konkurrenz als Triebfeder. „In der Hand die Atombombe und im Herzen noch immer die archaischen Instinkte unserer prähistorischen Ahnen“ (K. Lorenz). Ein solches Verständnis ergibt sich konsequenterweise aus der Evolutionslehre, auch wenn sie theistisch interpretiert wird.
1.3 Heilsgeschichtliche Zusammenhänge
Die Vorstellung, der Mensch habe sich langsam aus dem Tierreich emporentwickelt, ist mit dem Zeugnis des historischen Sündenfalls unvereinbar. Worin sollte der Sündenfall bestanden haben? Alles, was der Mensch und seine angenommenen Vorfahren getan haben, war gut und notwendig für die Höherentwicklung. Sünde und Schuld im biblischen Sinne kann es im Evolutionsdenken nicht geben. Damit könnte der Mensch aber auch nicht für seine Sünde zur Rechenschaft gezogen werden. Die Erlösung durch das Blut Jesu wird dadurch unnötig, ja geradezu sinnlos. Das zentrale Thema der Bibel, Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen, ginge an der Wirklichkeit vorbei.
Paulus nennt den ersten Adam, durch den die Sünde in die Welt kam, in einem Atemzug mit dem zweiten Adam, Christus, der die Erlösung von der Sünde bewirkt hat (Röm 5,12ff.) (Abb. 141). Wer war Adam im evolutionären Modell? Im Evolutionsmodell ist Adam als Person schwer vorstellbar. Durch ihn kann also die Sünde mit der Todesfolge nicht in die Welt gekommen sein. Wenn Paulus daher über Adam bildlich gesprochen hätte, warum sollte sich das in seinen Aussagen über Jesus Christus anders verhalten?

Abb. 141: Adam und Jesus Christus stehen einander gegenüber. Ihre Taten haben jeweils Bedeutung bzw. Folgen für alle Menschen.
Petrus verweist auf einen Zusammenhang zwischen Sintflutgericht und Endgericht (2 Petr 3,3-10). Auch Jesus bestätigt die Historizität der Sintflut (Mt 24,37–39).
Jesus selbst beruft sich mehrmals auf die ersten Seiten der Bibel und geht mit ihnen wie mit einem Tatsachenbericht um. So betont er auch die Erschaffung des ersten Menschenpaares und die Ehe als ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes (Mt 19,4f.).
Schließlich: Ist in einer evolutiven Sicht die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu noch möglich? Eine in Millionen Jahren gezählte Urgeschichte der Menschheit lässt diese Hoffnung leicht in der Ungewissheit ferner Jahrmillionen verblassen, wenn mit einem solchen Ereignis überhaupt noch ernsthaft gerechnet wird. Manche evolutionistische Zukunftsentwürfe deuten Jesu Wiederkunft völlig in ein Zum-Ziel-Kommen der Evolution um (Teilhard de Chardin), das mit dem biblischen Zeugnis vom göttlichen Gericht und der göttlichen Neuschöpfung von Himmel und Erde nichts mehr zu tun hat.
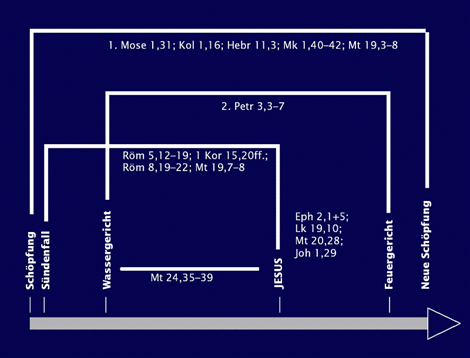
Abb. 143: Zwischen den Ereignissen der Urgeschichte und dem Neuen Testament bestehen vielfaltige Beziehungen. Insbesondere ist das Kommen und Wirken Jesu nur vor dem Hintergrund der biblischen Urgeschichte verstehbar.
Diese Beispiele machen deutlich, dass die biblische Urgeschichte mit zentralen Heilsaussagen der gesamten Heiligen Schrift unauflösbar verwoben ist (Abb. 143). Oder: Die biblische Urgeschichte steckt – als tatsächliches Geschehnis in der Menschheit – fest verwoben im Neuen Testament (Abb. 143).
1.4 Die Bedeutung des Todes
Ohne den Tod wäre Evolution nicht möglich. Stellvertretend zitieren wir dazu den Biologen Hans Mohr: „Gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod ist nicht ein Werk der Evolution. Der Tod des einzelnen ist vielmehr die Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes… Wenn wir also die Evolution des Lebens als ein in der Bilanz positives Ereignis, als die ‘reale Schöpfung’, ansehen, akzeptieren wir damit auch unseren Tod als einen positiven und kreativen Faktor“ (Leiden und Sterben als Faktum in der Evolution. Herrenalber Texte 44, 1983, S. 9–25).
Der Tod als notwendige Voraussetzung zum Hervorbringen des Lebens! Nichts könnte weiter von der biblischen Sicht des Todes entfernt sein (Röm 6,23; 1 Kor 15,26). Der Tod ist der Feind des Lebens, der von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung besiegt wurde, und nicht ein lebensspendender Faktor. Hier liegt ein zentraler Grundwiderspruch zwischen theistisch-evolutionistischen Vorstellungen und Inhalten der Bibel (Abb. 142).

Abb. 142: Gegensätzliche Beurteilung der „Kehrseiten“ der Schöpfung: Im Rahmen der Evolutionslehre ist das „Destruktive“ positiv zu werten als Voraussetzung der Höherentwicklung und damit der Entfaltung des Lebens; nach der biblischen Lehre dagegen ist es negativ – ein Zeichen des Verdorbenseins der Schöpfung.
Nach biblischem Zeugnis sind der geistliche sowie der leibliche Tod eine Folge der Sünde (Röm 5,12ff.) und mitnichten ein Schöpfungsmittel. Dass die ganze Schöpfung vom Tod als Sündenfolge betroffen ist, macht besonders Röm 8,19ff. deutlich, wo bezeugt wird, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde (und zwar nicht freiwillig, das heißt nicht durch eigene Schuld, sondern aufgrund der Ungehorsams-Tat des ersten Menschenpaares) (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|). Sie seufzt darunter und wartet wie die Christen auf Erlösung. Auch die theistisch geprägte Evolutionsvorstellung vom Tod ist also das genaue Gegenteil zur biblischen Lehre.
1.5 Schlussfolgerungen
Eine allgemeine Evolution hat auch in theistischer Interpretation Folgen für grundlegende Aussagen der Bibel, insbesondere des Neuen Testaments. Was wäre, wenn das Fundament der Schöpfung durch (theistische) Evolution ersetzt werden würde? Was wäre, wenn Gott durch Evolution geschaffen hätte?
- Es gäbe kein erstes Menschenpaar (dagegen: Mt 19,3-8; Röm 5,12ff.). Damit bräche die Gegenüberstellung Adam – Christus zusammen.
- Gott hätte den Menschen als Sünder erschaffen. Die Rechtfertigung des Sünders durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu würde keinen Sinn mehr machen.
- Gott hätte den Tod als schöpferisches Mittel eingesetzt. In biblischer Sicht ist der Tod jedoch ein Feind (1 Kor 15,26) und er ist durch Jesus entmachtet worden (2 Tim 1,10).
1.6 Literaturhinweise
Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004, https://www.wort-und-wissen.org/produkt/jesus-darwin-und-die-schoepfung/.
Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.
Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.
Autor: Reinhard Junker, 03.02.2005
© 2005, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2022.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament (Experten)
In diesem Artikel wird gezeigt, welche Folgen die Akzeptanz einer evolutiven Abstammung des Menschen aus dem Tierreich für das Verständnis des Neuen Testaments und seiner Botschaft von Jesus Christus hat.
2.1 Einleitung
Im Artikel |0.5.1.1.1 Biblische Gründe für eine theistische Evolution?| werden Argumente besprochen, die als Begründung für eine Harmonisierung des evolutionären Weltbildes und des biblischen Schöpfungszeugnisses angeführt werden. Solche Harmonisierungsversuche werden auch als „theistische Evolution“ (von Gott ermöglichte bzw. gesteuerte Evolution) bezeichnet. Es wird dort gezeigt, dass diese Argumente nicht stichhaltig sind. Im Folgenden werden biblische Zusammenhänge aufgezeigt, die deutlich gegen eine Zusammenschau von allgemeiner Evolution und Schöpfung im biblischen Sinne sprechen. Es soll gezeigt werden, dass und weshalb die Interpretation von Evolution als Schöpfungsvorgang biblisch gesehen nicht tragfähig ist. Der entscheidende Zusammenhang ist: Die biblische Urgeschichte steckt – als tatsächliches Geschehnis in der Menschheit – fest verwoben im Neuen Testament.
2.2 Unverzichtbare Inhalte aller Evolutionstheorien
Um beurteilen zu können, ob Evolution als Schöpfungsmethode Gottes (= „theistische Evolution“) interpretiert werden könnte, ist es erforderlich, eine geeignete „Bezugsgröße“ herzustellen. Angesichts unterschiedlicher Evolutionsvorstellungen soll der „kleinste gemeinsame Nenner“ aller Evolutionsvorstellungen zusammengestellt und zugrundegelegt werden. Es handelt sich dabei um Theoriebestandteile aller Evolutionsauffassungen – auch theistisch verstandener –, ohne welche eine Evolution, welcher Art auch immer, schlechterdings unmöglich wäre. Die nachfolgende (nicht vollständige) Aufzählung fasst in Kürze einige wichtige Aussagen zusammen.
- Im Laufe der Zeit erfolgt eine Komplexitätszunahme (Atome – Moleküle – Makromoleküle – Einzeller – Vielzeller usw.).
- Die Evolutionsgeschichte umfasst einige Milliarden Jahre; die Menschheit ist mindestens zwei Millionen Jahre alt.
- Alle Arten von Lebewesen, die heute lebenden und die ausgestorbenen, sind durch gemeinsame Abstammung von einem ersten einzelligen Urlebewesen miteinander verbunden.
- Für den Menschen bedeutet dies eine Abstammung aus dem Tierreich; der Mensch ist ein umgewandeltes Tier (vgl. Abb. 138). Wie immer das Szenario vom Tier zum Menschen gedacht wird, es liegt in der Natur evolutionärer Vorgänge, dass nicht nur die körperlichen Eigenschaften, sondern auch die Verhaltensmerkmale des Menschen – seien es günstige oder ungünstige – aus den Gesetzmäßigkeiten der Evolution abzuleiten sind (vgl. 140 Abb. 140). Zu den Erklärungszielen der Evolutionsforschung gehört auch eine vollständig naturgesetzliche Ableitung des menschlichen Verhaltens.

Abb. 138: Solche Bilder von „Affenmenschen“ beinhalten zwar mehr Phantasie als Realität, dennoch gehören solche Vorstellungen zur Theorie einer Abstammung des Menschen aus dem Tierreich.

Abb. 140: Konkurrenz als Triebfeder. „In der Hand die Atombombe und im Herzen noch immer die archaischen Instinkte unserer prähistorischen Ahnen“ (K. Lorenz). Ein solches Verständnis ergibt sich konsequenterweise aus der Evolutionslehre, auch wenn sie theistisch interpretiert wird.
- Evolution läuft in Populationen ab, nicht von Individuum zu Individuum. Populationen (= durch Kreuzung miteinander verbundene Individuen einer Art) sind die Grundeinheit der Evolution.
- Eine der notwendigen Voraussetzungen für eine evolutive Entstehung der Artenvielfalt einschließlich des Menschen ist eine Überproduktion von Nachkommen und in deren Folge eine Auslese (Selektion) der am besten Angepassten auf Kosten der schlechter Angepassten (|1.3.2.2.1 Natürliche Selektion|. Mutationen (Änderungen des Erbguts) sind die einzige bekannte Quelle für neue Varianten von Lebewesen (|1.3.2.1.1 Mutation|). Diese Quelle der Mutation bringt in großem Ausmaß (in über 99% der Fälle) verminderte Vitalität, Erbdefekte, Krankheiten und Missbildungen hervor, die durch Selektion wieder ausgemerzt werden müssen (vgl. Abb. 139).

Abb. 139: Einer schlägt den anderen: das ist eine der wichtigsten Triebfedern evolutionärer Entwicklungen. Schöpfung durch Evolution heißt Schöpfung durch Kampf ums Dasein.
- Evolution kann nur ablaufen, wenn es den individuellen Tod und den Artentod (Aussterben) in großem Maße gibt. Ohne Tod keine Evolution. Die Menschheit ist auf den Tod ungezählter Individuen und das Aussterben einer immensen Zahl von Arten gebaut.
Was folgt nun aus diesen Inhalten der Evolutionstheorie? Inwieweit betreffen sie biblische Inhalte? Nachfolgend werden einige Punkte zusammengestellt.
2.3 Adam und das „Tier-Mensch-Übergangsfeld“
Wenn der Mensch von Gott durch Evolution erschaffen wurde, betrifft dies das Menschenbild. Im evolutionären Rahmen stellt sich die Frage, an welcher Stelle des Stammbaums der Evolutionslehre Adam (sei es als Individuum oder als Repräsentant einer Evolutionsstufe) einzusetzen sei. Wo beginnt die Menschheit? Im Rahmen der Evolutionslehre wird ein Tier-Mensch-Übergangsfeld angenommen. Die Schwammigkeit dieses Begriffes ist der Kleinschrittigkeit des evolutionären Prozesses durchaus angemessen. Denn ein eindeutig definierbares bzw. auszumachendes erstes Menschenpaar bzw. eine von Tieren klar abgrenzbare erste Menschenpopulation kann es im Evolutionsgeschehen nicht geben, da sich der Formenwandel in Populationen vollzieht (s.o.). Es ist also letztlich nicht möglich, das Menschsein vom Tiersein abzugrenzen, wenn man von Evolution ausgeht.
Konrad Lorenz bezeichnet den heutigen Menschen als Bindeglied zwischen Affe und Mensch. Diesem Gedanken hat sich auch Carsten Bresch verschrieben: Das dunkle Tal auf dem Weg vom Tier zum Menschen haben wir noch nicht ganz durchschritten: das wahre, eigentliche Menschsein wird erst in der Zukunft verwirklicht. Ähnlich meint Hoimar von Ditfurth, der Mensch habe das Tier-Mensch-Übergangsfeld noch nicht völlig durchschritten und sich als wahrer Mensch noch nicht vollständig verwirklicht. Konsequenterweise werden Fehlbarkeit und Sünde des Menschen als Folgen des evolutionären Prozesses angesehen (s. u.).
Evolutionär gesehen gibt es also den Menschen an sich nicht, sondern nur verschiedene Stadien eines Prozesses, die sich nicht qualitativ unterscheiden.
Nach dem biblischen Schöpfungsbericht ist der Mensch dagegen zum Bilde Gottes geschaffen und wurde als Verwalter über die Schöpfung eingesetzt (1 Mose 1,28). Der Mensch ist sozusagen Gottes Stellvertreter. Diese Aufgabe ist zweifellos höchst anspruchsvoll und von einem primitiven „Urmenschen“, der sich – evolutionär interpretiert – in einer allmählichen Entwicklung aus dem Tierreich entwickelt hätte, nicht im entferntesten zu bewältigen. Vor einem evolutionären Hintergrund macht die im biblischen Schöpfungsbericht genannte Beauftragung des Menschen keinen Sinn.
Jesus Christus selber bestätigt indirekt die Erschaffung des Menschen, wie sie in den ersten beiden Kapiteln der Bibel (1. Mose 1 und 2) geschildert wird. In einer seiner Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern seiner Zeit geht es um die Frage der Ehe und Ehescheidung. Bemerkenswerterweise begründet Jesus seine Antwort damit, dass er auf den Ursprung verweist, wie Gott den Menschen am Anfang gemacht hat. Im Matthäusevangelium ist dieses Gespräch überliefert:
„Da traten Pharisäer an ihn heran, die ihn auf die Probe stellen wollten, und legten ihm die Frage vor: Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund entlassen (oder: sich von seiner Frau scheiden)? Er gab ihnen zur Antwort: Habt ihr nicht gelesen (1. Mos. 1,27), dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat (1. Mos. 2,24): ‚Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hangen, und die beiden werden e i n Fleisch sein‘? Also sind sie nicht mehr zwei, sondern e i n Fleisch. Was somit Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.
Sie entgegneten ihm: Warum hat denn Mose geboten (5. Mos. 24,1), der Frau einen Scheidebrief auszustellen und sie dann zu entlassen? Er antwortete ihnen: Mose hat euch (nur) mit Rücksicht auf eure Herzenshärte gestattet, eure Frauen zu entlassen (oder: euch von euren Frauen zu scheiden); aber von Anfang an ist es nicht so gewesen“ (Mt. 19,3-8).
Im Gespräch Jesu mit den Pharisäern können wir zwei Beobachtungen machen, die unser Thema betreffen:
- Als Orientierung für die ihm gestellte Frage zur Ehescheidung gilt für Jesus das, was in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift über die Erschaffung des Menschen und die Erschaffung von Mann und Frau gesagt wird. Das ist für ihn maßgeblich. Was in 1. Mose 1 und 2 gesagt wird, versteht Jesus selber als tatsächliches Geschehnis am Anfang der Menschheit, das in keiner Weise relativiert oder neu gedeutet wird. Die Ehe ist eine Einrichtung des Schöpfers und soll vom Menschen nicht geschieden werden.
- Die Pharisäer wenden dann aber ein, dass im mosaischen Gesetz doch die Möglichkeit einer Scheidung angesprochen sei. Jesu Antwort darauf ist besonders interessant. Er stellt nämlich zum einen fest, dass Scheidung eine Erlaubnis wegen der Hartherzigkeit des Menschen ist, und zum anderen, dass dies ursprünglich anders war: „Von Anfang an ist es nicht so gewesen.“ Anfangs gab es keine Scheidebriefregelegung. Warum nicht? Es gibt nur einen plausiblen Grund: Es gab keine Notwendigkeit dazu, weil das menschliche Herz am Anfang noch nicht „hart“ war. Damit wird deutlich, dass Jesus einen Unterschied zwischen dem Anfang und dem späteren Zustand des Menschen sieht. Der Mensch war nicht von Anfang an hartherzig, wurde es aber später.
Für die Frage nach der Vereinbarkeit von Schöpfung und Evolution ist dieses Gespräch Jesu mit den Pharisäern sehr aufschlussreich. Denn durch das Zitieren aus 1. Mose 1 und 2 bestätigt Jesus, dass es ein erstes Menschenpaar gab. Dies ist in einem evolutionären Kontext jedoch nicht möglich. Außerdem macht Jesus deutlich, dass es einen Bruch in der Menschheitsgeschichte gab, durch den der Mensch hartherzig wurde. Auch dies ist in einem evolutionären Szenario nicht denkbar, denn wenn der Mensch ein „umgewandelter Affe“ ist, hat er dessen Verhalten evolutiv erworben, einschließlich solcher Verhaltensweisen, die beim Menschen als „hartherzig“ zu charakterisieren sind.
In der Sache gibt es hier also nur ein Entweder – Oder: Entweder die biblische Schilderung und die Auffassung Jesu geben den wirklichen Anfang des Menschengeschlechts wieder oder das evolutionäre Szenario eines Tier-Mensch-Übergangsfeldes.
Der Bruch, den Jesus in seiner Antwort andeutet, wird ausdrücklich und ausführlich im 5. Kapitel des Römerbriefs thematisiert. Deutliche Anklänge daran sind auch in Römer 8 zu hören. Damit kommen wir zum nächsten Punkt.
2.4 Wenn der Mensch einem evolutionären Tier-Mensch-Übergangsfeld entstammt, gab es keinen Sündenfall
Wenn es – evolutionär gesehen – keinen ersten Menschen und kein erstes Menschenpaar gab, kann sich auch kein Sündenfall ereignet haben, wie er in 1. Mose 3 geschildert wird und im Neuen Testament häufig zugrundegelegt wird. Ein Umbruch von der von Sünde unverdorbenen Welt in die Welt der Sünde kann evolutionstheoretisch nicht gedacht werden. Dieses Geschehen wird an vielen Stellen der Bibel aber vorausgesetzt, besonders deutlich im fünften Kapitel des Römerbriefs. Daraus zitieren wir hier einige Verse:
„Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben -. . .
Also: Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung. Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen als Gerechte hingestellt werden.“ (Röm 5,12.18.19)
In diesem Text wird der eine Adam, durch den die Sünde in die Welt kam, dem einen, Jesus Christus, gegenübergestellt, durch den Rechtfertigung und Leben gewährt wird (s. Abb. 141). Die Person und das Wirken Jesu werden der Person und der Tat Adams gegenübergestellt. Beide sind insofern vergleichbar, als ihre Taten Folgen für die gesamte Menschheit hatten: Durch Adam kamen die Sünde und als Folge der Tod in die Welt, durch Jesus Christus die Rechtfertigung und das Leben (V. 18: „lebenwirkende Rechtfertigung“). „Rechtfertigung“ bedeutet, dass der Mensch, obwohl er als Sünder verloren ist, durch Jesu Stellvertretung dennoch vor Gott als gerecht dastehen kann und daher gerettet ist – wenn er dieses Angebot persönlich für sein Leben annimmt (wie am Ende von V. 17 anklingt). Sünde und Rechtfertigung stehen also einander gegenüber und ebenso ihre jeweiligen Folgen: der Tod (als Folge der Sünde) und das Leben (als Folge der Rechtfertigung) (V. 18f.).

Abb. 141: Adam und Jesus Christus stehen einander gegenüber. Ihre Taten haben jeweils Bedeutung bzw. Folgen für alle Menschen.
Die Gegenüberstellung Adam – Jesus Christus macht deutlich, dass Adam eine historische Persönlichkeit ist, wie es auch bei Jesus der Fall ist. Die Gegenüberstellung dieser beiden Personen lässt keinen anderen Schluss zu. Adam war das Einfallstor für die Sünde und den Tod. Damit ist klar: Zentrale Themen des Neuen Testaments wie die Rechtfertigung und Sündenvergebung und damit verbunden der Zugang zum ewigen Leben sind eng verknüpft mit dem Einbruch der Sünde in die Welt; er bildet den Hintergrund der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Existiert dieser Hintergrund (im Rahmen der Evolutionslehre) aber nicht, macht auch die Erlösung durch Jesu Sterben und Auferstehung keinen Sinn. Wenn die Sünde des Menschen nämlich Folge des von Gott gesteuerten evolutionären Prozesses wäre (eine Konsequenz einer theistisch gedeuteten Evolution, s. u.), könnte der Mensch auch nicht zur Rechenschaft dafür gezogen werden. Damit wäre aber unverständlich, weshalb Jesus Christus stellvertretend für die Menschen am Kreuz sterben musste, was das Neue Testament betont bezeugt.
In Röm 5,12ff. wird auch ausdrücklich gesagt, dass die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt einbrach. Diesen einzigen gibt es im Rahmen einer vom Tier zum Menschen verlaufenden Evolution nicht. Der in Röm 5,12-19 dargelegte Zusammenhang zwischen Adam und Jesus passt also nicht zu einem evolutiven Ursprung des Menschen, auch und gerade dann nicht, wenn er von Gott gelenkt worden wäre.
In Röm 5,12ff. ist der leibliche Tod gemeint, da der Tod als Folge der Sünde verstanden wird. Der geistliche Tod (die Trennung des Menschen von Gott) kann hier nicht gemeint sein, da „Sünde“ mit „geistlichem Tod“ gleichzusetzen ist. Röm 5,12 sagt daher, dass der geistliche Tod (= Sünde) den (leiblichen) Tod zur Folge hat. Im Zusammenhang des Textes vor und nach Röm 5,12 kann der Tod ebenfalls nur leiblich verstanden werden (es ist vom Sterben Jesu die Rede und vom Sterben der Väter nach Adam).
Das Seufzen der Schöpfung. Aufschlussreiche Auskunft über die Situation der gegenwärtigen Schöpfung gibt eine Passage aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs. In den Versen 19-22 wird von einer Knechtschaft der Vergänglichkeit und einem Seufzen der Schöpfung gesprochen, sowie von einem sehnsüchtigen, gespannten Warten („Harren“) auf Befreiung von dieser Situation. Der jetzige Zustand der gesamten Schöpfung entspricht nicht dem ursprünglichen: die Schöpfung (auch die außermenschliche) wurde der Nichtigkeit bzw. der Vergänglichkeit unterworfen; sie war also früher anders. Damit wird unausgesprochen ein früherer Zustand der Schöpfung vorausgesetzt, der das Kennzeichen der Vergänglichkeit und des Seufzens noch nicht besaß. (Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|.)
Dieses Verhängnis des Unterworfenseins unter die Knechtschaft der Vergänglichkeit war nicht von von Anfang an verwirklicht (und wird auch nicht immer bleiben); es gehört nicht zur ursprünglichen Schöpfung (Gott hat keine seufzende, geknechtete Schöpfung geschaffen). Die Unterwerfung ist um des Menschen willen geschehen (V. 20). Das verweist auf die Tat Adams als Auslöser für den Zustand des Unterworfenseins und des Seufzens. Der Unterwerfer selber kann jedoch nur Gott sein, denn nur er kann auf Hoffnung hin unterwerfen. Auch die Verwendung des sog. „göttlichen Passivs“ („wurde unterworfen“) weist in diese Richtung. (Der „göttliche Passiv“ wird im biblischen Sprachgebrauch häufig verwendet, um das Handeln Gottes zu umschreiben.)
Aus Röm 8,18ff. folgt, dass die Schöpfung ursprünglich wesensmäßig anders beschaffen war als heute. Sie wurde der Vergänglichkeit unterworfen und besaß somit ursprünglich dieses Merkmal nicht.
Auch diese Schilderung der durch eine Unterwerfung geknechteten und der Vergänglichkeit anheimgestellten Schöpfung passt nicht zu einem evolutionären Weltbild. Denn dort ist die Schöpfung schon immer der Vergänglichkeit unterworfen; etwas anders gibt es nicht und wird es nicht geben. Und diese Situation ist im Rahmen der Evolutionslehre unabhängig vom Fall des Menschen – wieder entgegen Römer 8,19ff.
Dass es ursprünglich eine anders geartete Schöpfung gab, wird auch durch die Nahrungszuweisung im Schöpfungsbericht (1. Mose 1,29-30) unterstrichen: Den Tieren und dem Menschen wurde ursprünglich ausschließlich pflanzliche Nahrung zugewiesen. „Und es geschah so“ (1. Mose 1,30) – im evolutionären Werdegang ist dies dagegen zu keinem Zeitpunkt so verwirklicht gewesen.
Das biblische Verständnis des Geknechtetseins der Schöpfung, ihres „Gleichgewichts des Schreckens“ des Fressens und Gefressenwerdens ist also grundverschieden und unvereinbar mit einem evolutiven Naturverständnis. Dort ist dieses Gleichgewicht Motor der Entwicklung, hier dagegen ein Ausdruck dessen, dass die Schöpfung ihren ursprünglichen Frieden verloren hat (s. Abb. 142).

Abb. 142: Gegensätzliche Beurteilung der „Kehrseiten“ der Schöpfung: Im Rahmen der Evolutionslehre ist das „Destruktive“ positiv zu werten als Voraussetzung der Höherentwicklung und damit der Entfaltung des Lebens; nach der biblischen Lehre dagegen ist es negativ – ein Zeichen des Verdorbenseins der Schöpfung.
„Schöpfung durch Evolution“ bedeutet das Unterfangen, beides harmonisieren zu wollen. Wie soll das möglich sein? Schöpfung durch Evolution hieße Schöpfung durch Überproduktion, Auslese der Bestangepassten, Konkurrenz und Tod – das passt nicht zu dem, was die Bibel über Gottes Schöpfungshandeln sagt (vgl. |0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsvorgang|).
2.5 Bewertung der Sünde
Wie kann „Sünde“ im Rahmen der Evolutionslehre verstanden werden? Wie bereits angesprochen, kann eine Verhaltensevolution nicht von der Evolution von Körperstrukturen abgekoppelt werden. Das bedeutet: Wenn Gott die körperliche Evolution ermöglicht oder gelenkt hat, so muss dies konsequenterweise auch für das Verhalten gelten. Sündiges Verhalten bzw. Sünde schlechthin ist damit Folge der Evolution, deren notwendige Begleiterscheinung. Denn im Rahmen der Evolutionslehre gilt: In Existenz ist alles, was sich evolutiv bewährt hat, was zum Überleben dienlich war. So muss beispielsweise die Aggressivität des Menschen durch seine evolutionäre Vergangenheit verstanden werden. Aber nicht nur ungünstige Verhaltensweisen, sondern auch positive Seiten menschlichen Zusammenlebens, kurz seine Natur insgesamt, stellen sich als Ergebnis evolutionärer Prozesse dar. Alles, was den Menschen ausmacht, hat sich evolutionstheoretisch gesehen unter den Lebensbedingungen unserer Vorfahren als zweckmäßig herausgestellt, sonst hätten sich entsprechende Merkmale des Verhaltens nicht durchsetzen können. Diese Situation hat K. Lorenz prägnant auf den Punkt gebracht, als er die Menschheitssituation wie folgt diagnostizierte: „In der Hand die Atombombe und im Herzen noch immer die archaischen Instinkte unserer prähistorischen Ahnen“ (s.o. Abb. 140). Das Übel in der Welt gab es – evolutionär gesehen – also schon vor dem Menschen und unabhängig von seinem Tun. Indem der Mensch evolutiv entstand, wurde er notwendigerweise, ungewollt, gleichzeitig zum Sünder. Theistische Evolution heißt: Gott schuf den Menschen als Sünder. Gibt es eine Möglichkeit, im Deutungsrahmen der Evolutionslehre diese Schlussfolgerung zu vermeiden? Überlegungen dazu werden im Artikel |0.5.1.4 Evolution des Leibes, aber Erschaffung der Seele?| diskutiert. Evolution konsequent zu Ende gedacht, lässt aber keinen Ausweg aus dieser Konsequenz erkennen: Sünde ist nicht durch das Tun des Menschen bedingt; der Wille des Menschen war nicht beteiligt. Der Mensch ist Sünder, genauso wie er Geschöpf ist oder genauso wie er (biologisch) Säugetier ist.
2.6 Bewertung des Todes
Vielleicht der schwerwiegendste theologische Einwand gegen die Evolutionsanschauung resultiert aus der Rolle und Bedeutung des Todes in der Schöpfung. Während in evolutionärer Perspektive der Tod letztlich als kreativer Faktor zu werten ist (ohne Tod keine Evolution und damit keine Schöpfung, wenn Evolution als Schöpfungsmethode Gottes verstanden wird), ist der Tod in biblischer Sicht die Verneinung des Lebens. Der Tod ist Folge der Sünde und gerade nicht ein Ausdruck des schöpferischen Handeln Gottes. Aus Röm 5,12-14 geht hervor, dass der körperliche Tod als Sündenfolge eingeschlossen und nicht nur der geistliche Tod gemeint ist. Die Heilige Schrift geht noch weiter und bezeichnet den Tod als „Feind Gottes“, der besiegt wird (1 Kor 15,26). Durch Jesu Tod und Auferstehung ist er bereits besiegt. Die Auferstehung Jesu ist der Sieg über den Tod. Es ist nicht ersichtlich, wie der Tod einerseits (in evolutionärer Perspektive) Mittel der Schöpfung und Ausdruck der guten Schöpfung Gottes sein kann, andererseits in biblischer Sicht zugleich eine besiegenswerte Macht ist.
Tod in der Fossilüberlieferung. Weiter oben wurde erläutert, dass in biblischer Sicht das Seufzen und die Vergänglichkeit in der Natur nicht zur ursprünglichen Schöpfung gehören, sondern die Schöpfung infolge einer „Unterwerfung“ in diesen Zustand versetzt wurde – in Mitleidenschaft mit dem Menschen. Dies hat gewaltige Konsequenzen für die Deutung der Fossilüberlieferung, denn Fossilien sind nicht nur Zeugnisse vergangenen Lebens, sondern auch Zeugnisse des Todes in der Schöpfung. Der Tod kam erst durch den Menschen in die Welt – nach Römer 8,19ff. ausdrücklich in die gesamte außermenschliche Schöpfung (vgl. Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| und |0.2.1.3 Die Bindung der Erdgeschichte an den Sündenfall des Menschen|). Daher ist die Fossilüberlieferung und die Entstehung der betreffenden fossilführenden Gesteine an die Menschheitsgeschichte gekoppelt. Es ist biblisch geurteilt folglich nicht möglich, die Fossilüberlieferung sozusagen in die Schöpfungswoche hinein zu verlegen. Denn als Gott „sprach“ (1. Mose 1) und aufgrund seines schöpferischen Wortes die Werke der Schöpfung ins Dasein kamen, war das Ergebnis nicht eine seufzende, dem Tod verfallene und geknechtete Welt, die sich in unzähligen, meist gewaltsam verschütteten Fossilien widerspiegelt. Die Fossilüberlieferung passt nicht zum Schöpfungsbericht der Bibel.
Da die Menschheitsgeschichte nach der Bibel nur Jahrtausende zählt (siehe |0.2.1.2 Der kurze Zeitrahmen der Urgeschichte: Nur einige Jahrtausende|, gilt dies aufgrund des eben erläuterten Zusammenhangs der Menschheitsgeschichte mit der Geschichte des Lebens auch für alle anderen Lebewesen. Die geologischen Schichten, die Fossilien bergen, müssen daher ebenfalls im Rahmen einer kurzen Erdgeschichte interpretiert werden. Auch wenn die biblische Urgeschichte das Menschheitsalter oder das Alter der Erde nicht ausdrücklich angeben, so folgt doch aufgrund des Zusammenhangs der Geschichte der ganzen Schöpfung mit dem Schicksal des Menschen eine ungefähre Größenordnung von einigen Jahrtausenden.
Daraus resultieren zweifellos große Herausforderungen für eine biblisch-urgeschichtliche Geologie. Denn die ältesten fossilführenden Schichten mit tierischen Fossilien werden von der Historischen Geologie auf ca. 550-600 Millionen Jahre datiert, und die Erde selbst soll ca. 4,6 Milliarden Jahre alt sein. Eine der biblischen Urgeschichte verpflichtete Wissenschaft muss also die zugrundeliegenden Befunde aus den Geowissenschaften völlig neu in einem um Größenordnungen geringeren Zeitrahmen deuten. Diese Aufgabe kann kaum unterschätzt werden, und viele wissenschaftliche Befunde scheinen deutlich gegen eine Deutung im Rahmen einer jungen Erde oder auch nur einer kurzen Geschichte des Lebens entgegenzustehen. Doch wenn der biblischen Überlieferung Priorität eingeräumt wird, gibt es zu dieser Aufgabe keine Alternative.
2.7 Zusammenfassung
Eine allgemeine Evolution hat auch in theistischer Interpretation Folgen für grundlegende Aussagen der Bibel, insbesondere des Neuen Testaments. Das Schöpfungshandeln Gottes ist der Ausgangspunkt für alles Weitere. Was wäre, wenn das Fundament der Schöpfung durch (theistische) Evolution ersetzt werden würde? Was wäre, wenn Gott durch Evolution geschaffen hätte?
- Es gäbe kein erstes Menschenpaar (Mt 19,3-8; Röm 5,12ff.). Damit bräche die Gegenüberstellung Adam – Christus zusammen (s. o. Abb. 141).
- Gott hätte den Menschen als Sünder erschaffen. Die Rechtfertigung des Sünders durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu würde keinen Sinn mehr machen.
- Gott hätte den Tod als schöpferisches Mittel eingesetzt. In biblischer Sicht ist der Tod jedoch ein Feind (1 Kor 15,26) und er ist durch Jesus entmachtet worden (2 Tim 1,10).
Die Schöpfungsfrage ist also nicht weniger wichtig als das, was Jesus für die Menschen getan hat. Beides hängt untrennbar miteinander zusammen (vgl. Abb. 143). Wenn einem Jesus und sein Erlösungswerk wichtig ist, muss das auch für die Frage der Entstehung und die Geschichte des Menschen gelten, da Jesu Wirken ohne diesen Hintergrund nicht verstanden werden kann und da Jesu Kommen keinen Sinn mehr machen würde, wenn der Mensch einen Tier-Mensch-Übergangsfeld entstammen würde.
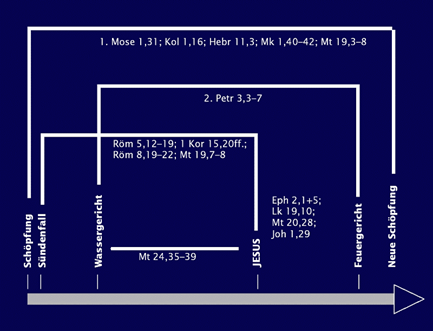
Abb. 143: Zwischen den Ereignissen der Urgeschichte und dem Neuen Testament bestehen vielfaltige Beziehungen. Insbesondere ist das Kommen und Wirken Jesu nur vor dem Hintergrund der biblischen Urgeschichte verstehbar.
Literaturhinweise: Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004.
Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.
Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.
2.8 Zitierte Literatur
- Bresch: Zwischenstufe Leben. Evolution ohne Ziel? München, 1977; vgl. auch Bresch (Anm. 1).
- Lorenz, zit. nach: Riedl, Rupert: Diskussionsbeiträge. In: R. Riedl & F. Kreuzer (Hg.) Evolution und Menschenbild. Hamburg, 1983, S. 121–136. (Zitat: S. 133)
- v. Ditfurth: Wir sind nicht nur von dieser Welt. Hamburg, 1981, S. 21.
Autor: Reinhard Junker, 14.06.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/e2022.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode? (Interessierte)
Wenn Gott durch Evolution geschaffen hätte, wären die Evolutionsmechanismen Ausdruck seines schöpferischen Wirkens. Gemessen an den biblischen Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes stellen die Evolutionsmechanismen das genaue Gegenteil dar.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird die Methode einer Erschaffung mit Hilfe der Evolutionsmechanismen beleuchtet und gezeigt, dass biblische Kennzeichnungen des Schöpfungshandelns Gottes nicht zu den Evolutionsmechanismen passen.
1.1 Einleitung
Die Vorstellung von Evolution als Vorgang der Schöpfung ist untrennbar auch mit der Frage der Schöpfungsmethode verbunden. Ein evolutionäres Erschaffen schließt ein, dass die Evolutionsmechanismen die Art und Weise darstellen, wie Gott die Lebewesen erschafft. Es mag sein, dass diese Mechanismen keine alleinige Erklärung der Entstehung von Neuem in der Evolution bereitstellen, dennoch gehören sie in Konzepten einer theistischen Evolution zu den Schöpfungsmechanismen dazu.
1.2 Erschaffung durch Mutation und Selektion?
Die Mutations-Selektions-Methode (|1.3.2.1 Mutation|, |1.3.2.2 Natürliche Selektion|) der als Schöpfung gedeuteten Evolution wäre eine höchst ineffiziente und ungemein fragwürdige, ja paradoxe „Schöpfungsmethode“. Die Erschaffung des Menschen, aber auch der anderen Geschöpfe würde nämlich auf einem ungeheuren Ausschuss basieren – einem Ausschuss von weniger angepassten Individuen und von aussterbenden Arten. Denn zum Selektionsprinzip gehört die Überproduktion von Nachkommen und eine Auslese der am besten Angepassten auf Kosten der weniger gut Angepassten. Schöpfung durch Evolution heißt, dass Gott sich des Selektionsvorgangs (Auslese) bedient hätte, um die Arten, auch den Menschen, zu erschaffen. Auch wenn die Selektionstheorie in der Biologie nicht das „Recht des Stärkeren“ bedeutet, so folgt aus ihr doch, dass nur auf Kosten des Todes ungezählter Individuen und Arten (Aussterben) eine allmähliche Höherentwicklung erfolgte. Ohne diesen zahlenmäßig weit überwiegenden „Ausschuss“ wäre eine Evolution höherorganisierter Organismen nicht abgelaufen. Auch der Mensch wäre dann nicht entstanden.
Wird Gott als souveräner Schöpfer – und das heißt in der Sichtweise einer theistischen Evolution als Lenker des evolutionären Prozesses – bezeugt, dann ist er natürlich auch der Lenker der zu über 99% schädlichen Mutationen. Warum – so muss man dann fragen – arbeitet Gott nicht nur mit den evolutionsfördernden Mutationen?
1.3 Fragwürdiges Gottesbild
Ein durch Evolution schaffender Gott hätte sich also einer Methode bedient, die höchst ineffizient, in keiner Weise vorausschauend und ausgesprochen stümperhaft wäre. Welcher Gott stünde hinter einer solchen Schöpfungsmethode durch Evolution? Wäre die stammesgeschichtliche Evolution die Schöpfungsmethode Gottes, hieße das beispielsweise, dass der Schöpfer auf der frühen Erde eine „Ursuppe“ Hunderte von Millionen Jahren existieren ließ, um ein erstes Bakterium zu erschaffen, oder dass er Mord und Kannibalismus benutzte, um affenähnliche Wesen in Menschen zu verwandeln. Und so kann man viele weitere Beispiele anfügen.
Die bekannten Evolutionsmechanismen können also kaum als Ausdruck schöpferischen Handelns gewertet werden. Sie sind vielmehr nur in der Lage, vorhandene Strukturen zu erhalten (durchaus auch zu optimieren). Es handelt sich sozusagen um „Erhaltungsmechanismen“, nicht um „Schöpfungsfaktoren“. Und dass diese Faktoren teilweise destruktiv sind, hängt mit der Todesverfallenheit der Schöpfung infolge des göttlichen Gerichts über die Sünde zusammen (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|).
1.4 Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes
Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes betonen dagegen Gottes Weisheit, Einsicht, Kraft und Größe in seinem schöpferischen Wirken (Spr 3,19; Jer 27,5; Röm 1,19f. u. a.). Das Selektionsprinzip – als Schöpfungsmethode interpretiert – könnte mit diesen Begriffen nicht umschrieben werden. Somit wird deutlich, dass Selektion keine Schöpfungsmethode im biblischen Sinne sein kann.
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es wird nicht bestritten, dass Selektionsprozesse existieren. In einer von der Sünde gezeichneten Welt ist Selektion jedoch nur ein regulierender, kein kreativer Faktor (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|).
1.5 Die Taten Jesu
Das schaffende Handeln Gottes kann man sich nicht anschaulich vorstellen. An den Vollmachtstaten Jesu ist jedoch das Schöpfungshandeln Gottes durch das Wort beispielhaft erkennbar, etwa in der im 1. Kapitel des Markusevangeliums berichteten Heilung eines Aussätzigen. Die Wiederherstellung von Gliedern und die Neuschaffung einer gesunden Haut ist gleichermaßen ein Wunder wie die Erschaffung der Sterne. An diesem Handeln erkennt man, dass Schöpfung aus dem Wort keine evolutiven Zeitspannen erfordert und dass Gott in seinem Wirken nicht durch die biologischen, chemischen oder physikalischen Gesetzmäßigkeiten eingeschränkt ist (wenn er sich ihrer auch bedienen kann).
1.6 Wann war die Schöpfung „sehr gut“?
Die Bibel sagt, dass die Schöpfung vom Schöpfer selbst als sehr gut beurteilt wurde (Genesis 1,31). An welcher Stelle des Evolutions-Szenarios ließe sich dagegen sagen, die Schöpfung sei „sehr gut“? Dieses Urteil des Schöpfers könnte allenfalls als „zur Höherentwicklung fähig“ umgedeutet werden – was der Text aber sicher nicht nahelegt. Viele Evolutionsbiologen behaupten, Evolution führe teilweise zu gravierenden Mängeln der Lebewesen; der Wiener Zoologe Rupert Riedl spricht sogar von „katastrophaler Planung“, hätte jemand die Lebewesen geplant. Diese Einschätzung ist subjektiv und anfechtbar (siehe |1.3.5.3 Rudimentäre Organe|; theistische Evolutionsanschauungen müssen sich aber besonders mit ihr auseinandersetzen.
Bei diesen Überlegungen spielt es keine Rolle, ob Gott ein Evolutionsgeschehen nur einmal angestoßen hat, etwa bei einem Urknall, oder ob er weitergehend in das Evolutionsgeschehen eingegriffen hat. Wenn die Evolutionslehre wahr wäre, hätte Gott z. B. Tausende von Parasiten von vornherein gewollt, ebenso die auf Fressen und Gefressenwerden angelegten ökologischen Zusammenhänge. Nach dem biblischen Zeugnis dagegen hat Gott dem Menschen und den Tieren zunächst ausdrücklich nur pflanzliche Nahrung zugewiesen (Genesis 1,29f.). Der heute zu beobachtende Daseinskampf zwischen den Organismen („Fressen und Gefressenwerden“) ist Kennzeichen einer von Gott abgefallenen Schöpfung. Im Schöpfungsmodell wird von einer ursprünglich anderen Ökologie ausgegangen (Genesis 1,29f.). (Näheres dazu in den Artikeln |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| und |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung|.)
1.7 Zusammenfassung
Die Evolutionsmechanismen wären Schöpfungsmechanismen; Zufallsmutationen und darauf folgende Auslese der Bestangepassten wären ein Mittel der Schöpfung – dies wäre eine höchst ineffiziente „Schöpfungsmethode“ und darüber hinaus bedeutete es eine Legitimation des Übels in der Welt. Abb. 144 fasst die Problematik in einer Gegenüberstellung zusammen.
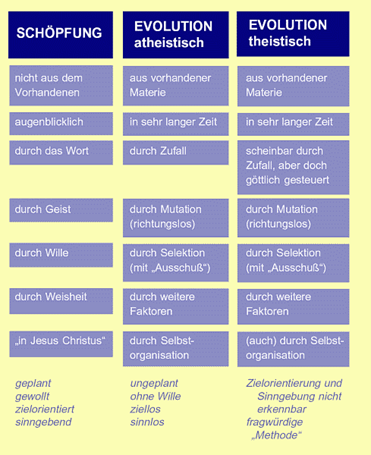
Abb. 144: Graphische Darstellung der Problematik der Evolutionsmechanismen im Kontrast zu den biblischen Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes.
1.8 Literaturhinweise
Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.
Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004.
Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.
Autor: Reinhard Junker, 16.06.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2023.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode? (Experten)
2.0 Inhalt
In diesem Artikel wird die Methode einer Erschaffung mit Hilfe der Evolutionsmechanismen beleuchtet und gezeigt, dass biblische Kennzeichnungen des Schöpfungshandelns Gottes nicht zu den Evolutionsmechanismen passen.
2.1
Die Vorstellung von Evolution als Vorgang der Schöpfung ist untrennbar auch mit der Frage der Schöpfungsmethode verbunden. Ein evolutionäres Erschaffen schließt ein, dass die Evolutionsmechanismen die Art und Weise darstellen, wie Gott die Lebewesen erschafft. Es mag sein, dass diese Mechanismen keine alleinige Erklärung der Entstehung von Neuem in der Evolution bereitstellen, dennoch gehören sie in Konzepten einer theistischen Evolution zu den Schöpfungsmechanismen dazu.
2.2 Schöpfungsmethode Gottes
Nach der Auffassung aller Vertreter theistischer Evolutionsanschauungen steht Gott als treibende Kraft hinter dem Evolutionsgeschehen. Ein „Dieu évoluteur“ (Teilhard de Chardin) würde sich jedoch einer tötenden Schöpfungsmethode, nämlich der Methode der Zufallsmutation und Auslese der am besten Angepassten (Selektion) bedienen, wenn die Evolutionstheorie die Entstehung der Arten richtig beschreiben und wenn Gott dieses Geschehen lenken würde oder angestoßen hätte. Für diese Einschätzung spielt keine Rolle, wie man sich die Wirkung Gottes im Evolutionsgeschehen konkret vorstellen soll. Das Selektionsprinzip würde in jedem Fall gelten. Auch wenn mit diesem Prinzip nicht einfach das „Recht des Stärkeren“ gemeint ist, so besagt es doch, dass nur auf Kosten des Todes und des Leidens ungezählter Individuen und Arten (Aussterben) eine allmähliche Höherentwicklung möglich war. Ohne diesen „Ausschuss“ wäre eine Evolution höherorganisierter Organismen nicht abgelaufen. Die Schöpfungsmethode Gottes durch Evolution hätte gewaltige Krisen und Katastrophen sowie einen erheblichen Verlust an biologischer Substanz in Kauf genommen. Angesichts dieses destruktiven, lebensverneinenden Aspekts einer Schöpfungsmethode durch Evolution erscheint die Frage „War der Teufel auch dabei?“ von W. Heitler folgerichtig. Denn in der Schöpfung findet man heute neben dem Zweckmäßigen und Schönen auch das Destruktive und Grausame. Mit der Auffassung, Gott habe sich dieser Mechanismen bedient, um die Schöpfungswerke hervorzubringen, ist daher die Konsequenz gekoppelt, dass die Kehrseiten der Schöpfung zum Wesen der „guten Schöpfung“ Gottes gehören. Diese Problematik wird bei Verhältnisbestimmungen von Evolutionslehre und Theologie fast durchweg ausgespart. Zum biblischen Verständnis des Destruktiven in der Schöpfung siehe Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|.
2.3 Zielgerichtetheit
Die bekannten Evolutionsfaktoren geben keinen Hinweis darauf, dass der durch sie bewirkte Prozess des Artenwandels in irgendeinem Sinne gerichtet wäre. Im Gegenteil deutet alles im Gebiet der kausalen Evolutionsforschung auf die Ungerichtetheit der beobachtbaren Evolutionsprozesse hin. Auch bei behaupteten makroevolutionären Übergängen gehen die Evolutionstheoretiker von einer Ungerichtetheit aus. Dieser Zufallsprozess soll die Artenvielfalt hervorgebracht haben, den Menschen eingeschlossen.
Was heißt vor diesem Hintergrund und seinen evolutiven Deutungen, dass Evolution die Methode der Schöpfung ist? Man könnte darauf verweisen, dass der Zufall nur scheinbar Zufall ist. In der Tat ist „Zufall“ im Grunde genommen eine Umschreibung für Nichtwissen. Vielleicht sind zufällig erscheinende Ereignisse in Wirklichkeit doch gesteuert. Ein verborgenes Steuerelement könnte darin liegen, dass die Materie so beschaffen (bzw. geschaffen) ist, dass sie notwendigerweise durch ein ungerichtetes „Zufallsspiel“ doch zu Höherentwicklung gelangt. Nach dieser Vorstellung hätten in der Evolution jedoch auch ganz anders gestaltete Formen anstelle des Menschen entstehen können. Allerdings könnte man annehmen, Gott habe den Zufall kanalisiert. Was uns als Zufall erscheint, sei in Wirklichkeit Gottes Handeln. Das würde aber heißen, dass Gott auch die große Überzahl (> 99%) an schädlichen Zufallstreffern (Mutationen) gelenkt hat – und zwar zum Negativen hin. Die Lenkung der vorteilhaften mutativen Änderungen (woraus konstruktive Entwicklungswege resultieren sollen) wäre durch ein Übermaß an destruktiven Wandlungsschritten kaschiert, so dass sich daraus für den forschenden Wissenschaftler ein Anschein von Zufälligkeit und Ziellosigkeit ergibt.
Die Methode des Erschaffens mit Mutationen (|1.3.2.1.1 Mutation|) wäre höchst ineffizient und ungemein fragwürdig, ja paradox. Die Erschaffung des Menschen, aber auch der anderen Geschöpfe würde nämlich so verlaufen: Es wird eine große Anzahl Mutationen produziert, von denen aber über 99% wieder ausgelesen werden müssen, nämlich die mehr oder weniger nachteiligen Mutationen. Ohne diesen zahlenmäßig weit überwiegenden „Ausschuss“ wäre eine Evolution höherorganisierter Organismen nicht abgelaufen. Auch der Mensch wäre dann nicht entstanden.
Wird Gott als souveräner Schöpfer – und das heißt in der Sichtweise einer theistischen Evolution als Lenker des evolutionären Prozesses – bezeugt, dann ist er natürlich auch der Lenker der zu über 99% schädlichen Mutationen. Warum – so muss man dann fragen – arbeitet Gott nicht nur mit den evolutionsfördernden Mutationen?
2.4 Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes
Die Kennzeichen der Evolutionsmechanismen entsprechen als Schöpfungsmittel nicht den biblischen Kennzeichnungen des schöpferischen Handelns Gottes bzw. Jesu Christi (s. u.). Es ist zu bedenken, dass derselbe Gott, der die Welt erschaffen hat, sich in Jesus Christus offenbart hat. In Jesus ist „alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist“ (Kol 1,16; vgl. Joh 1). Daher ist es berechtigt, die Schöpfungsmethode durch Evolution dem im Wirken Jesu zum Ausdruck kommenden Wesen Gottes gegenüberzustellen. Die schöpferischen Taten Jesu waren durch Barmherzigkeit und Liebe gekennzeichnet. Diese Charakterisierungen treffen auf den (auch theistisch verstandenen) Evolutionsprozess gerade nicht zu.
„Die Identität Gottes des Schöpfers und Gottes des Erlösers … das ist die theologische Achse des Evangeliums“ schreibt Gilkey, der (dennoch) eine theistische Evolution vertritt. Man müsste also trotz des Zusammenhangs von Schöpfung und Erlösung annehmen, dass Gott in der Schöpfung einerseits und in der Erlösung andererseits auf gegensätzliche Weise gehandelt hätte. Besonders der Geist der Bergpredigt mit den dortigen Seligpreisungen widerspricht den Prinzipien der Evolution. Jesus Christus nahm sich insbesondere der Schwachen an, derer, die keine Aussichten hatten, als die Bestangepassten im Kampf ums Dasein zu überleben, um in der Sprache der Evolutionslehre zu sprechen. „Wer unter euch groß sein will, sei euer aller Diener“ (Mt 20,26).
Mit diesem Widerspruch müssen sich Verfechter aller Varianten einer theistischen Evolution auseinandersetzen. Wenn die Evolutionslehre eine zutreffende Rekonstruktion der Kosmosgeschichte wäre, hätte Gott die auf Fressen und Gefressenwerden angelegten ökologischen Zusammenhänge von vornherein gewollt und als Schöpfungsmethode eingesetzt, entgegen der offensichtlichen Tatsache, dass Jesus Christus der Struktur dieser Welt, die als Voraussetzung evolutionärer Entwicklungsmöglichkeit verwirklicht sein muss, widersprach.
Wenn Hübner vor dem Hintergrund der Evolutionslehre sagt, dass die Liebe, die in Jesus Christus ist, den Daseinskampf überwunden habe, impliziert er ein sich diametral wandelndes Gottesbild bzw. -handeln. Denn der von Christus überwundene Daseinskampf wäre von ihm selber inszeniert oder wenigstens geduldet worden. Diese Bewertung trifft auch auf Bosshards Feststellung zu, dass die evolutive Schöpfungsmethode einen hohen Tribut an Katastrophen und Verlusten zollen musste, wenn er andererseits später von einer „behutsamen Leitung“ der Evolution in die Zukunft hinein spricht. Kurz davor erwähnt er Katastrophen, die „vielleicht unentbehrlich“ gewesen seien, um der Evolution entscheidende Anstöße zu versetzen; sie mussten allerdings gut dosiert sein, um das Leben nicht völlig auszulöschen.
Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes betonen Gottes Weisheit, Einsicht, Kraft und Größe in seinem schöpferischen Wirken (Spr 3,19; Jer 27,5; Röm 1,19f. u. a.). Die Evolutionsmechanismen – als Schöpfungsmethode interpretiert – könnten mit diesen Begriffen nicht umschrieben werden. Somit wird deutlich, dass stammesgeschichtliche Evolution keine Schöpfungsmethode im biblischen Sinne sein kann.
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es wird nicht bestritten, dass die Evolutionsfaktoren existieren. In einer von der Sünde gezeichneten Welt sind sie jedoch nur regulierende, keine kreativen Faktoren (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|).
2.5 Das Schöpfungshandeln des irdischen Jesus
Das Handeln des irdischen Jesus wirft Licht auf seine Schöpfung. Jesus schuf augenblicklich neue Gewebe und Organe bei Kranken wie z. B. beim Leprakranken (Aussätzigen), von dem im Markusevangelium berichtet wird (Mk 1,40-42: vgl. Joh 5,1ff.). Er verwandelte augenblicklich Wasser in Wein (und schuf damit eine Vielzahl organischer Moleküle), er vermehrte Brot, ohne an Zeit gebunden zu sein. Die Erschaffensmethode des Schöpfers hat Jesus Christus selbst gezeigt: Er schuf durch sein Wort, ohne Zeitverbrauch und in unerklärbarer Weise (die Evangelien enthalten sich jeglicher Andeutungen, wie Jesus es fertiggebracht hat, Brot zu vermehren, Kranke zu heilen und Tote aufzuerwecken). Hier sind keine Parallelen zu einer postulierten evolutionär verlaufenden Schöpfung Gottes zu finden – im Gegenteil: der Unterschied tritt deutlich hervor.
2.6 Theologische Bewertung des Daseinskampfes
Der Daseinskampf ist Realität. Aber er ist theologisch anders zu bewerten als es die Vertreter theistisch-evolutionistischer Vorstellungen tun:
Der Kampf ums Dasein ist nicht ein Mittel der Erschaffung der Lebewesen, sondern Gerichtszeichen nach dem Sündenfall des Menschen (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|). Der Unterschied dieser beiden Deutungen ist gewaltig: Im einen Fall wäre der Kampf ums Dasein ein Wesensbestandteil der Schöpfung vor dem Sündenfall und Ausdruck des Schöpfungshandelns Gottes. Im anderen Fall wäre er auf einen in der Schöpfung durch den Fall aufgrund des Gerichtshandelns Gottes vorhandenen Widerspruch gegen die Schöpfung zurückzuführen. Es ist also kein Argument für die Vereinbarkeit des Prinzips „Kampf ums Dasein“ und des Schöpfungshandelns Gottes, wenn darauf verwiesen wird, dass Gott doch auch „grausam“ handle, wenn er z. B. seinem Volk befahl, ganze Städte oder Völker vom Säugling bis zum Greis auszurotten. Dabei handelt es sich um Gerichte, nicht um schöpferisches Wirken. Es sind Maßnahmen zur Eindämmung des Bösen, zur Verhinderung eines noch größeren Unheils, und keine Mittel zur Hervorbringung der Schöpfung.
In diesem Sinne ist auch dem Einwand zu begegnen, Gott selber habe doch in der Geschichte seines alttestamentlichen Gottesvolkes geradezu grausam gehandelt, oder der Auffassung, dass die natürliche Auslese genauso eine Einrichtung Gottes sei wie der Staat, oder wie es der Wille des Vaters gewesen sei, dass sein Sohn leiden sollte. Doch auch dieses Handeln Gottes war Gerichtshandeln, nicht Mittel zur Hervorbringung der Schöpfung; es folgt aus dem Einbruch der Sünde in die Welt und ist ein Zeichen dafür, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Ebenso ist die Notwendigkeit staatlicher Gewalt erst in einer Welt der Sünde erforderlich. Das Gerichtshandeln Gottes trifft im Übrigen nicht bevorzugt die Schwachen und Unangepassten, sondern ist als Konsequenz von Ungehorsam zu verstehen.
2.7 Wann war die Schöpfung „sehr gut“?
Die Bibel sagt, dass die Schöpfung vom Schöpfer selbst als sehr gut beurteilt wurde (Genesis 1,31). An welcher Stelle des Evolutions-Szenarios ließe sich dagegen sagen, die Schöpfung sei „sehr gut“? Dieses Urteil des Schöpfers könnte allenfalls als „zur Höherentwicklung fähig“ umgedeutet werden – was der Text aber sicher nicht nahelegt. Viele Evolutionsbiologen behaupten, Evolution führe teilweise zu gravierenden Mängeln der Lebewesen; der Wiener Zoologe Rupert Riedl spricht sogar von „katastrophaler Planung“, hätte jemand die Lebewesen geplant. Diese Einschätzung ist subjektiv und anfechtbar (siehe |1.3.5.3.1 Rudimentäre Organe|; theistische Evolutionsanschauungen müssen sich aber besonders mit ihr auseinandersetzen.
2.8 Zusammenfassung
Die Evolutionsmechanismen wären Schöpfungsmechanismen; Zufallsmutationen und darauf folgende Auslese der Bestangepassten wären ein Mittel der Schöpfung – dies wäre eine höchst uneffiziente „Schöpfungsmethode“ und darüber hinaus bedeutete es eine Legitimation des Übels in der Welt. Abb. 144 fasst die Problematik in einer Gegenüberstellung zusammen.
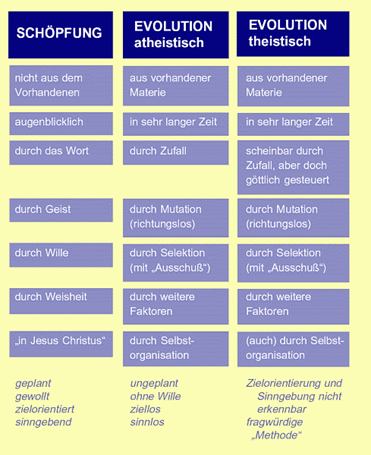
Abb. 144: Graphische Darstellung der Problematik der Evolutionsmechanismen im Kontrast zu den biblischen Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes.
2.9 Literaturhinweise
Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.
Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004, https://www.wort-und-wissen.org/produkt/jesus-darwin-und-die-schoepfung/.
Bosshard, Stefan Niklaus: Erschafft die Welt sich selbst? Die Selbstorganisation von Natur und Mensch aus naturwissenschaftlicher, philosophischer und theologischer Sicht. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1987.
Gilkey, Langdon: Der Himmel und Erde gemacht hat. München: Claudius, 1971.
Heitler, Walter: Die Natur und das Göttliche. Zug: Klett & Balmer, 1974.
Hübner, Jürgen: Biologie und christlicher Glaube. Konfrontation und Dialog. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1973.
0.5.1.4 Evolution des Leibes, aber Erschaffung der Seele?
Manche Christen und eine Reihe von Autoren rechnen mit Eingriffen Gottes ins Evolutionsgeschehen – sei es durch besondere Akte oder dadurch, dass Gott in irgendeiner Weise in die Evolutionsmechanismen eingreift. Eine allgemeine Evolution wird zwar grundsätzlich beibehalten, aber durch zusätzliches Wirken Gottes ergänzt. Dieses Konzept ist aber aus mehreren Gründen fragwürdig.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird gezeigt, mit welchen Problemen man konfrontiert ist, wenn man annimmt, Gott habe ins Evolutionsgeschehen eingegriffen, insbesondere, um den Menschen zu erschaffen und ihm dadurch eine Sonderstellung in der Schöpfung zu ermöglichen.
1.1 Einleitung
In den Artikeln |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament| und |0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode?| wurde gezeigt, dass das Konzept einer theistischen Evolution (Schöpfung durch Evolution) biblisch nicht tragfähig ist. Konsequent weitergedacht bedeutet eine Evolution des Menschen aus dem Tierreich letztlich, dass auch das Evangelium von Jesus Christus nicht mehr glaubhaft ist. Diese Konsequenz versuchen manche Christen und auch eine Reihe von Autoren zu vermeiden, indem sie Eingriffe Gottes ins Evolutionsgeschehen zulassen – sei es durch besondere Akte oder dadurch, dass Gott in irgendeiner Weise in die Evolutionsmechanismen eingreift. Eine allgemeine Evolution wird zwar grundsätzlich beibehalten, aber durch zusätzliches Wirken Gottes ergänzt.
1.2 Eingriffe Gottes in die Evolution – die Lösung?
Eine Reihe christlicher Autoren (besonders auf katholischer Seite, aber auch evangelikal orientierte Theologen und Naturwissenschaftler) versucht, die Konsequenzen einer stammesgeschichtlichen Verwurzelung der Menschen zu vermeiden. Sie weisen darauf hin, dass es „gemäßigte“ Evolutionsvorstellungen gebe. Diese Autoren heben hervor, dass die naturgesetzlichen Vorgänge nicht ausreichen, um den Evolutionsablauf zu ermöglichen. (Evolutionstheoretiker versuchen allerdings, diese Wissenslücke durch natürliche Erklärungen zu füllen.) Daraus folge, dass die Naturwissenschaft den Evolutionsprozess nicht vollständig erklären könne. Ein besonderes Handeln Gottes (ein „Eingreifen“) wird in entscheidenden Phasen der Evolution als erforderlich betrachtet, insbesondere bei der Entstehung des Menschen. Die Evolution als Ablauf wird also nicht grundsätzlich problematisiert, jedoch die Mechanismenfrage, also durch welche Faktoren und auf welche Weise Evolution erfolgt.
Einige Autoren halten es auch für möglich, im evolutionären Kontext die Geschichtlichkeit Adams und eines paradiesischen Urzustandes zu vertreten. Einerseits sei der erste Mensch zwar biologisch gesehen primitiv gewesen (Zugeständnis an die Evolutionslehre), andererseits aber Person und damit das Subjekt, das Gott zum Partner seines Bundes machen konnte (Bindung an die Offenbarung). Damit soll eine Sonderstellung des Menschen sowie der Sündenfall und die darauf beruhende Erlösungsbedürftigkeit des Menschen in einem ansonsten evolutionären Kontext beibehalten werden.
Neue Aktualität hat diese Vorstellung durch das 1996 veröffentlichte Votum des Papstes zur Evolutionstheorie erhalten. Der L’Osservatore Romano schreibt am 1. November 1996 dazu: „Der menschliche Körper hat seinen Ursprung in der belebten Materie, die vor ihm existiert. Die Geistseele hingegen ist unmittelbar von Gott geschaffen.“ Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass mit der vor dem Menschen existierenden Materie tierische Vorfahren gemeint sind. Dies hat Papst Johannes Paul II. auch insofern zum Ausdruck gebracht, als er die Evolutionslehre als mehr als nur eine Hypothese bezeichnete.
Was wird mit solchen Konstruktionen gewonnen? Zunächst soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine solche Konzeption den entschiedenen Protest der Evolutionsbiologen nach sich ziehen würde, denn mit der Evolutionsforschung wird das Ziel einer vollständig naturalistischen Erklärung der Entstehung aller Lebensaspekte verfolgt.
Die Auffassung, Evolution mit besonderen Eingriffen Gottes und wissenschaftlich prinzipiell nicht fassbaren („übernatürlichen“) Faktoren zu ergänzen, ist ein dogmatisch motivierter Einspruch gegen eine konsequente Evolutionsauffassung, die eben alles erklären will. Gerade an den entscheidenden Stellen (Entstehung des Lebens, Entstehung neuer Konstruktionen, Entstehung des Menschen) werden Inhalte der Evolutionslehre zurückgewiesen. Durch diesen Kunstgriff soll die Sonderstellung des Menschen auch im Fluss der Evolution aufrechterhalten werden, um auch im evolutionären Kontext christliche Glaubensinhalte beibehalten zu können. Steht die Sonderstellung des Menschen auf dem Spiel, besteht offenbar Motivation, Aussagen der Evolutionslehre zu hinterfragen.
Bemühungen dieser Art sind aber aus verschiedenen Gründen fragwürdig. Dies soll im Folgenden angesprochen werden.
1.3 Durchbrechung des Evolutionsprinzips
Wie bereits angesprochen, gehört es zum Ziel der Evolutionstheoretiker, eine vollständige kausale Erklärung aller Lebensphänomene und ihrer Entstehung zu geben. Dem Einwand, dies habe man nicht erreicht, halten Evolutionstheoretiker entgegen, dass es in Zukunft noch gelingen werde. Um diesen Einwand wiederum zu entkräften, müsste der Nachweis erbracht werden, dass es prinzipiell nicht möglich ist, „von unten“ zu erklären. Dafür gibt es zweifellos beachtliche Bemühungen (die hier aber nicht Gegenstand der Betrachtungen sind). Es genügt hier aber die Feststellung, dass ein prinzipieller Abweis der naturwissenschaftlichen Bemühungen, die entscheidenden Veränderungen im Laufe der Evolution erklären zu können, die Evolutionsforschung schlechthin in Frage stellt. Denn es wäre sonderbar, wenn ausgerechnet die wesentlichen Schritte im Evolutionsprozess auf Faktoren zurückgeführt werden müssten, die auf Wirkungen jenseits des empirisch Fassbaren beruhen, also der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode unzugänglich sind. Gerade an den entscheidenden Stellen würde das Evolutionsprinzip durchbrochen. Evolutionstheoretiker sehen dazu in der Regel keine Veranlassung; sie müssten ihr Forschungsprogramm aufgeben. Von Evolution könnte man dann nicht mehr in Bezug auf das Entstehen von Neuem sprechen, sondern nur in Bezug auf das Ausprägen des Vorhandenen auf jeweils anderweitig erreichten Evolutionsstufen. Das entspräche zwar dem Wortsinn von „Evolution“ („Herauswälzung“, Ausprägung von Vorhandenem), aber nicht dem Anspruch und Inhalt der Evolutionslehre. Wird die Entstehung des Neuen nicht-evolutionär erklärt, so ist die Evolutionslehre ihres Kernstückes beraubt. Eine Evolutionslehre, die die Entstehung des Neuen in der Evolution nicht erklären will, ist keine Evolutionslehre, vielmehr ein Mix aus evolutionären und schöpferischen Elementen. Gerade Bemühungen im Sinne „gemäßigter“ theistischer Evolutionsanschauungen machen damit unfreiwillig deutlich, dass eine Harmonisierung von biblischen Inhalten und Inhalten der Evolutionslehre eben nicht möglich ist.
1.4 Leib, Seele und Geist können nicht strikt getrennt werden
Die seelisch-geistigen und körperlichen Aspekte des Menschen können nicht strikt voneinander geschieden werden. Körper, Seele und Geist bilden eine Einheit; Wohltaten oder Verletzungen des Körpers betreffen auch Seele und Geist und umgekehrt. Karl Rahner bemerkt hierzu, dass wenn die Seele „forma corporis“ (formende Instanz des Körpers) ist, dann eine Aussage über Gottes unmittelbares Erschaffen der menschlichen Geistseele zugleich auch eine Aussage über das leibliche Erscheinungsbild sei. Aufgrund des Zusammenhangs von Leib, Seele und Geist ist es abwegig, eine körperliche Evolution abgesehen vom seelischen Aspekt der Organismen anzunehmen. Die Unterscheidung zwischen körperlicher Evolution und dem Erwerb von Geist und Seele ist nicht möglich, da Geist und Seele nicht unverbunden neben dem Leib existieren – mehr noch: es gibt gute Gründe für die Sichtweise, dass der materielle Aspekt des Menschseins und allen Lebens nicht ausreicht, um Lebensäußerungen zu verstehen. Das Materielle steht im „Dienst“ immaterieller Instanzen.
Die Nicht-Trennbarkeit (wohl Unterscheidbarkeit) von Leib, Seele und Geist kommt in zahlreichen biblischen Texten zum Ausdruck, in denen die verschiedenen Aspekte des Menschseins zur Sprache kommen. Leibliches und Seelisches wird oft geradezu synonym gebraucht. Die Trennung von Geist-Seele und Leib ist platonisch, nicht biblisch. „Das animalische Leben gehört für das Alte Testament immer untrennbar mit dem sittlich-geistigen Leben zusammen“ (Th. Steinbüchel).
1.5 Eingriffe in die Evolution sind ein Nachbessern
Der einflussreiche Vertreter einer konsequent theistischen Evolutionsvorstellung, Teilhard de Chardin, lehnt die Vorstellung von einem Eingreifen Gottes in die Evolution ab, weil Gottes Wirken eben gerade in diesem Prozess seinen Ausdruck finde. Wenn Evolution die Methode der Schöpfung ist, sollte man erwarten, dass sie zum Ziel führt und nicht an den entscheidenden Stellen Nachhilfe benötigt. Wenn Gott durch Evolution schafft, ist ein Nachbessern ein Zeugnis von Flickschusterei. Solche Eingriffe würden die Unzulänglichkeiten der sonstigen evolutiven Schöpfungsmethode nachträglich korrigieren. Damit ist eine weitere Problematik solcher „Eingriffs-Vorstellungen“ auf den Punkt gebracht: Wenn Gott schon durch Evolution geschaffen hat, weshalb dann nicht vollkommen? Es ergibt sich hier also die seltsame Situation, dass Gott einerseits die Welt so geschaffen habe, dass sie evolviert, dass aber an entscheidenden Stellen das Evolutionsgeschehen nicht ausreicht. Gott muss seine eigene Schöpfungsmethode also noch durch weitere Maßnahmen ergänzen.
1.6 Die Problematik des Todes und der Evolutionsmechanismen wird nicht gelöst
Schließlich darf nicht übersehen werden, dass die in den Artikeln |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament| und |0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode?| erläuterte Problematik der „evolutionären Schöpfungsmethode“ und des Todes in der Schöpfung durch gemäßigte theistisch-evolutionistische Konzepte nicht entschärft oder gar gelöst wird. Auch nach „gemäßigten“ Vorstellungen ist der physische Tod des Menschen unabhängig von seiner Sünde – entgegen Röm 5,12ff. (vgl. |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament|). Und auch hier müssten die Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmechanismen interpretiert werden – mit all den in Artikel |0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode?| erläuterten Problemen.
Schlussfolgerung: Die Vorstellung, dass der Leib evolutiv entstanden, die Geist-Seele dagegen auf Schöpfungsakte zurückzuführen sei, ist aus den genannten Gründen unbefriedigend. Außerdem löst dieser Ansatz einige schwerwiegende Probleme einer theistischen Evolution auch nicht, insbesondere die Frage nach der Bedeutung des Todes.
Autor: Reinhard Junker, 09.06.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2024.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.2 Sündenfall und Biologie
0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung (Interessierte)
Die heutige Schöpfung funktioniert nur auf der Basis von Fressen und Gefressenwerden von Tieren. Die Räuber-Beute- und Wirt-Parasiten-Beziehungen sind sehr komplex. Um sich von anderen Tieren ernähren oder als Parasit leben zu können, benötigen die betreffenden Lebewesen oft ausgeklügelte Einrichtungen.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel werden einige Einblicke in Einrichtungen für den Erwerb und Verzehr tierischer Nahrung, von Räuber-Beute-Beziehungen und parasitären Lebensformen gegeben.
1.1 Problemstellung
Eines der Standardargumente gegen ein historisches Verständnis der biblischen Urgeschichte ist das Fressen und Gefressenwerden in der Schöpfung. Es wird wie folgt argumentiert: In 1. Mose 1,29-30 wird geschildert, dass die Tiere und der Mensch nur pflanzliche Nahrung zu sich nehmen sollten: Es wird auch ausdrücklich gesagt, dass es auch so geschah. Heute aber ist das ganz anders. Viele Tiere erbeuten andere Tiere und benötigen dazu häufig ausgeklügelte Werkzeuge und Verhaltensweisen zum Beuteerwerb. Die Beutefangmechanismen sind oft so kompliziert, dass sie nicht durch Mikroevolution |1.3.1.3 Mikro- und Makroevolution| entstehen konnten; sie erfordern gegenüber Pflanzenfressern z. T. erhebliche Neukonstruktionen oder gewaltige Umkonstruktionen und damit Makroevolution. Wenn es aber nach den Vorstellungen der Schöpfungslehre keine Makroevolution gibt, wie kommen dann die komplizierten Räuber-Beute-Beziehungen zustande? Sie müssten von vornherein am Anfang der Schöpfung schon dagewesen sein. Das würde aber dem biblischen Schöpfungsbericht (s. o.) widersprechen.
Im Übrigen sei eine Welt ohne Tod und ohne Räuber-Beute-Beziehungen ökologisch gar nicht denkbar. Die biblische Schilderung von einer Welt ohne Tiernahrung sei daher unrealistisch. Sie könne allenfalls bildlich verstanden werden, nicht aber als Beschreibung eines tatsächlichen ursprünglichen Zustandes der Schöpfung.
Im Folgenden werden heutige ökologische Verflechtungen der belebten Welt anhand einiger typischer Beispiele geschildert. Damit soll beispielhaft dokumentiert werden, welche Unterschiede zwischen der uns vertrauten Ökologie und einer ganz andersartigen Ursprungsökologie bestehen. Daraus wird ersichtlich werden, dass der Übergang von einer Ursprungsökologie (wie in 1. Mose 1,29-30 angedeutet) zur heutigen Ökologie mit dem Fressen und Gefressenwerden in der Tat nicht durch mikroevolutive, natürliche Vorgänge erklärbar ist.
Im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| wird gezeigt, dass die biblischen Texte tatsächlich eine ursprüngliche Welt ohne Tod in der gesamten Schöpfung beschreiben, und zwar im Sinne einer realistischen Schilderung einer Schöpfung, die ursprünglich wesensmäßig anders gestaltet war als die heutige. Daraus folgt notwendigerweise, dass es einen Übergang oder einen Umbruch in die heutige „Todes-Ökologie“ gegeben haben muss. Einige biblische Texte geben Hinweise darauf, dass dieser Umbruch mit dem Sündenfall des Menschen zu tun hat. Der Sündenfall ist demnach ein für die gesamte Schöpfung einschneidendes Ereignis. Wie man sich einen solchen Übergang oder Umbruch aus biologischer Sicht vorstellen könnte, ist Gegenstand des Artikels |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung|.
1.2 Die ökologischen Verflechtungen
Um die Frage nach den möglichen Folgen des Sündenfalls für die Ökologie der Lebewesen angemessen angehen zu können, soll in diesem Artikel ein streifzugartiger Einblick in die heute beobachtbaren Wechselwirkungen zwischen den Organismen gegeben werden. Dabei wird nur auf diejenigen gegenseitigen Abhängigkeiten eingegangen, die Elemente enthalten, die mit dem Tod in der Schöpfung zu tun haben. Wir nennen solche Strukturen „fallsgestaltig“, weil sie hier als Folge des Sündenfalls betrachtet werden. Es geht dabei vor allem (aber nicht nur!) um destruktive Strukturen, die dazu da sind, andere Tiere zu schädigen oder zu töten. Dabei entsteht zwar ein einseitiges Bild, doch soll gerade die negativen Wechselwirkungen zwischen Lebewesen dargestellt werden.
Das Fressen und Gefressen werden ist uns von Kindheit an so geläufig, dass es zu den größten Selbstverständlichkeiten gehört. Viele Tiere überleben nur auf Kosten anderer Tiere. Auch wenn man in Rechnung stellt, dass viele Raubtiere auch mit pflanzlicher Nahrung auskommen (z. B. im Zoo), bleibt doch die Tatsache, dass die Stabilität der heutigen Lebensgemeinschaften von ausgewogenen Räuber-Beute-Verhältnissen abhängt. Abb. 123 zeigt vereinfacht ein Nahrungsnetz.
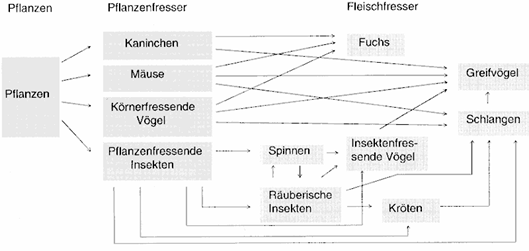
Abb. 123: Beispiel eines Nahrungsnetzes. Die Organismen hängen in einem komplexen Netz von Fressen und Gefressenwerden miteinander zusammen, hier dargestellt am Beispiel von Nahrungsketten in einem Waldrandgebüsch. Durch die Querverbindungen gibt es ein Nahrungsnetz.
Bei Abwesenheit der Räuber würden Beutetiere überhand nehmen und sich dadurch selbst die Nahrungsgrundlage entziehen; außerdem könnten sich Krankheiten seuchenhaft ausbreiten und die Population gefährden. Daher fungieren Räuber oft auch als „Gesundheitspolizisten“, indem sie kranke, schwache oder in irgendeiner Weise abnorme Individuen eher schlagen (können) als gesunde und kräftige.
1.3 Strukturen und Verhaltensweisen für den Beuteerwerb
Damit Tiere andere erbeuten und verzehren können, benötigen sie passende Körperstrukturen und Verhaltensweisen: Der Räuber muss seine Beute erkennen, überwältigen, verzehren und verdauen können. Im Folgenden sollen einige Beispiele solcher Strukturen und Verhaltensweisen geschildert werden. Es handelt sich dabei um Strukturen und Verhaltensweisen, die in einer Welt, wo den Tieren das „grüne Kraut“ zur Nahrung gegeben ist (1. Mose 1,30) sinnlos wären (= fallsgestaltige Strukturen, s. o.). In diesem Artikel geht es im Wesentlichen nur um Beschreibungen. Überlegungen, inwieweit diese fallsgestaltigen Merkmale im Laufe einer Mikroevolution nach der Erschaffung der Arten erworben werden konnten, werden im Artikel |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung| diskutiert. Die nachfolgenden Beispiele stammen meist aus Schröpel („Räuber und Beute.“ Landbuch-Verlag, 1986).
Strukturen und Verhaltensweisen, die den Nahrungserwerb ermöglichen. Um die Beute fangen zu können, bedarf es geeigneter Verhaltensweisen und Organe. Beides muss aufeinander abgestimmt sein. Zum Reißen und ggf. Kauen der Beute benötigen Tiere ein geeignetes Gebiss. Ein Raubtiergebiss unterscheidet sich von einem Grasfressergebiss stark; man vergleiche etwa das Gebiss eines Huftieres mit dem eines Raubtieres (Abb. 124). Auch wenn man mit einem Raubtiergebiss auch pflanzliche Nahrung zu sich nehmen kann, so ist es dafür doch nicht so gut geeignet und nicht dafür konstruiert.

Abb. 124: Fleisch- und Pflanzenfressergebiss. Fleischfressergebiss (Löwe; oben) und Pflanzenfressergebiss (Pferd; unten).
Oft aber sind Beutefangeinrichtungen ausgesprochen ausgeklügelt konstruiert. Zwei Beispiele: Die zu den Fangschrecken gehörende Gottesanbeterin (Mantis religiosa) schlägt ihre Beute mit dem zu wirkungsvollen Fanghaken umgebildeten ersten Beinpaar, mit dem sie blitzschnell und zielsicher zuschlägt. Der Fangschlag dauert nur 10-30 Millisekunden. Mit Hilfe von Sinnesborsten, die je nach Kopfdrehung gestaucht werden, kann die Mantis die Lage der Beute relativ zum Kopf bestimmen. Entsprechend wird die Schlagrichtung „eingestellt“. Bis ein geeignetes Beutetier in Reichweite gelangt, wartet das Insekt u. U. mehrere Stunden lang.
Durch Echopeilung mittels Ultraschall und Radar orten Fledermäuse ihre fliegende Beute. Die Fledermäuse können die von der Beute zurückkommenden Schallsignale analysieren, Entfernung und Flugrichtung der Beute bestimmen und ihre eigene Flugrichtung entsprechend einschlagen. Die Ultraschalltöne wären so laut wie ein Presslufthammer, wenn sie im für den Menschen hörbaren Bereich ausgestoßen würden. Die Schreie werden durch den Mund, bei einigen Fledermausfamilien durch die Nase ausgestoßen, wobei das Nasenblatt als eine Art Megaphon dient.
Diese Beispiele zeigen, dass eben geeigneten Beutefangorganen auch ein geeignetes Beutefangverhalten erforderlich ist. Ein Räuber muss sich anders verhalten als ein Pflanzenfresser.
Was die physiologische Seite betrifft, so ist tierische Nahrung leichter verdaulich als Pflanzennahrung. Ein Pflanzenköstler verträgt in der Regel auch tierische Nahrung.
Fangen der Beute. Viele Tierarten fangen ihre Beute gemeinsam durch ein koordiniertes Vorgehen. Ungemein „taktisch klug“ gehen Pelikane vor. Sie finden sich beim Fischfang zu Trupps zusammen und treiben Fischschwärme in die seichte Uferregion, um sie dann im flachen Wasser zu erbeuten.
Der Gepard (Acinonyx jubatus) setzt seine läuferischen Qualitäten ein, um die Beute ergreifen zu können. Er erreicht Spitzenwerte von über 100 km/h, die er allerdings nur über wenige 100 m durchhalten kann. Diese Geschwindigkeit wird durch eine besonders biegsame Wirbelsäule, die Beweglichkeit der Schulterblätter und die langen Beine ermöglicht.
Besonders hinterlistig sind die Fallenapparate der Spinnen. Jedermann geläufig ist das Netz von Radnetzspinnen, in welchem ahnungslose oder unvorsichtige Opfer hängen bleiben. Es gibt eine Unzahl weiterer Vorrichtungen, die mit Fangfäden arbeiten, z. B. Stolperdrähte als Signalüberträger oder Baldachine.
Der Schützenfisch (Toxotes jaculatrix) (Abb. 125) spuckt kleine Wassertropfen von der Oberfläche des Wassers auf Insekten, die in der über dem Ufer hängenden Vegetation sitzen. Er trifft auf Entfernungen von über 1 m mit unglaublicher Sicherheit. Die Lichtbrechung und Wellenbewegungen berücksichtigt der Fisch beim Zielen. Die Fähigkeit des Schießens wird durch eine vergleichsweise bewegliche Zunge ermöglicht, die er gegen den Gaumen pressen kann. Im Gaumen liegt eine Rinne, die mit der Zunge zusammen eine Art Blasrohr bildet. Durch kräftiges Schließen der Kiemendeckel wird Wasser aus der Mundhöhle durch die Röhre gepresst.
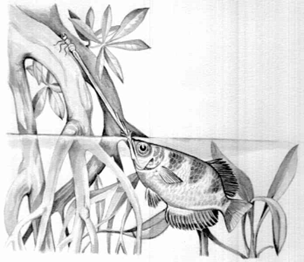
Abb. 125: Der Schützenfisch Toxotes ejaculatrix. Zeichnung: Marion Bernhardt
Verzehren der Beute. Schlangen, die ihre Beute verschlingen, besitzen ein kompliziertes Kiefergelenksystem, das ihnen diese Ernährungsweise ermöglicht. Die Unterkieferäste sind nicht fest verwachsen, sondern werden durch ein elastisches Band zusammengehalten. Beim Schlingakt weitet sich dieses Band sehr stark. Damit die Schlange während des Schlingaktes nicht erstickt, wird die Mündung der Luftröhre nach vorn, mitunter sogar seitlich aus dem Mund heraus verschoben. Ist die Beute in der Speiseröhre verschwunden, treiben starke Muskelbewegungen sie zum Magen weiter. Dieses Beispiel macht deutlich, dass praktisch die gesamte Körperkonstruktion der fleischfressenden Ernährungsweise angepasst sein kann, wobei alle Einrichtungen gleichzeitig vorhanden sein müssen.
Fleischfressende Pflanzen. Nicht nur Tiere schädigen oder töten einander, es gibt auch eine Reihe von Pflanzen, die von tierischer Nahrung leben, die fleischfressenden Pflanzen. Am Beispiel der tropischen Kannenpflanze (Nepenthes; Abb. 128) soll verdeutlicht werden, dass mehrere Strukturen ausgebildet und aufeinander abgestimmt sein müssen, damit die Nahrungsgewinnung gewährleistet ist. Als Fangapparat dient dieser epiphytisch [= auf anderen Pflanzen ohne Bodenkontakt] lebenden Pflanze ein kannenförmiges Fallenblatt, in welchem sich eine Verdauungsflüssigkeit befindet. Durch den farbigen Deckel und den farbigen Kannenrand werden Insekten angelockt. Der glitschige Kannenrand bringt die gelandeten Insekten zum Abrutschen ins Kanneninnere, wo diese dann verdaut und die Verdauungsprodukte von der Pflanze aufgenommen werden. Die aufgenommenen tierischen Stoffe werden in pflanzliches Eiweiß umgebaut.

Abb. 128: Das Kannenblatt der Kannenpflanze (Nepenthes)
1.4 Strategien der Feindabwehr
Auch zur Feindabwehr bedienen sich viele Beuteorganismen besonderer Strukturen und Verhaltensweisen. Viele Tiere sind durch einen Panzer, durch Stacheln und dergleichen relativ gut, wenn auch nie hundertprozentig, geschützt. Der Rotfeuerfisch (Pterois volitans) hat giftige Rückenflossenstacheln. Kopffüßer stoßen zum Schutz vor Verfolgern eine tarnende Tinte aus. Viele Tiere schrecken ihre Feinde durch Warnfarben ab, andere sondern schlecht schmeckende Sekrete ab. Andere schützen sich durch ein geschicktes Verhalten. So legen Hasen blind endigende Spuren um die Sasse herum, um schnüffelnde Hunde zu verwirren.
Manche Beutetiere wehren sich durch Feindbeschuss. Bombardierkäfer spitzen ein ätzendes Sekret aus dem Hinterleib. Durch die Verbindung des enzymatisch abgespaltenen Wasserstoffs mit Luftsauerstoff kommt es zu einer kleinen Knallgasexplosion.
Tarnung, Mimese und Mimikry. Ein geeignetes Mittel sowohl für Räuber und Beute sind Tarnung, Mimese und Mimikry. Tarnung hilft dem Räuber, nicht vorzeitig von der Beute entdeckt zu werden und umgekehrt. Unter Mimese versteht man die Ähnlichkeit mit belebten oder unbelebten Objekten der Umgebung in Form und Farbe. Sie soll mögliche Feinde dadurch fernhalten, dass ein uninteressantes Objekt vorgetäuscht wird. Berühmt hierfür ist das „Wandelnde Blatt“, eine tropische Gespenstheuschrecke, die einem grünen Laubblatt bis auf die Aderung ähnelt (Abb. 130).

Abb. 130: Das Wandelnde Blatt. Zeichnung: Marion Bernhardt
Mimikry liegt vor, wenn die Gestalt eines Tieres von einem anderen Tier nachgeahmt wird, um gefährlicher oder harmloser zu wirken, als man ist (Beispiel: Abb. 131).

Abb. 131: Mimikry am Beispiel des harmlosen Hornissenschwärmers (links), welcher die Hornisse (rechts) nachahmt.
1.5 Krankheit, Missbildungen, Tod
Ein weiterer Komplex biologischer Realität ist das Phänomen „Krankheit“. Praktisch alle Funktionen des Organismus können gestört werden, was im Extremfall den Tod zur Folge haben kann. Auf solche Störungen ist der Körper mehr oder weniger vorbereitet. So kann der Körper mit Hilfe seines Immunsystems Infektionsabwehrmaßnahmen durchführen. Eingedrungene gefährliche Substanzen können z. T. entgiftet oder vernichtet werden, entstandene Schäden können behoben werden.
Tod. Ein Grundsatz der Evolutionslehre könnte lauten: „Ohne Tod kein Leben.“ Tatsächlich gab der Paläontologe H. K. Erben einem seiner Bücher den Titel „Leben heißt Sterben“. Die heutige Ökologie ist in der Tat ohne Tod der Individuen, auch ohne vorzeitigen Tod (meist) der Mehrzahl der Nachkommen eines Elternpaars undenkbar, da andernfalls der vorhandene Lebensraum in kürzester Zeit überfüllt wäre. Die Grenzen des Lebensraums machen das Sterben unumgänglich. Gewöhnlich sterben die Organismen durch Räuber oder Parasiten; der Alterstod ist eher die Ausnahme.
1.6 Viren
Zahlreiche Krankheiten von Mensch, Tier und Pflanzen werden durch Viren hervorgerufen. Zu ihnen zählen Krankheiten wie der relativ harmlose Schnupfen als auch so gefährliche und zerstörerische Krankheiten wie Pocken, Tollwut, Kinderlähmung und AIDS. Viren sind so klein, dass sie nur im Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden können. Sie bestehen aus genetischem Material (DNS oder RNS), das von einer Proteinhülle umgeben ist. Ob man sie als Lebewesen ansehen möchte, ist Definitionssache. Jedenfalls können sich Viren nur mit Hilfe des Stoffwechsels fremder Zellen vermehren. Dabei werden die Wirtszellen zerstört. Die Wirkungsweise mancher Viren ist so „ausgeklügelt“, dass Portmann im Falle des Tollwutvirus die Kennzeichnung „dämonisch“ für angemessen hält.
1.7 Parasitismus
Als besonders auffällig „fallsgestaltig“ muss weiter die parasitäre Lebensweise genannt werden. Parasiten sind Lebewesen, die zeitweise oder ständig, ganz oder zum Teil auf Kosten eines anderen, in der Regel größeren Organismus, des sog. Wirtes, leben. Sie beziehen von ihm Nahrung, unter Umständen auch Wohnung oder ähnlichen Nutzen und töten ihn normalerweise nicht oder nicht sofort.
Man unterscheidet Ektoparasiten, die die Körperoberfläche des Wirtes kurzzeitig (z. B. Stechfliegen) oder bis zu lebenslang (z. B. Wanzen) besiedeln, und Endoparasiten, die im Innern des Wirtes leben (z. B. Bandwürmer).
Parasiten finden sich in fast allen Tierklassen, und faktisch alle Wirbeltierorgane können von Parasiten aufgesucht werden. Ein ganz erheblicher Teil der Tiere lebt parasitisch. In manchen Gegenden der Erde sind fast alle Menschen von Wurmparasiten befallen, oft sogar von mehreren Arten. Man kennt alle Übergänge von scheinbar folgenlosem Nebeneinander beider Partner bis zum extrem einseitiger Schädigung. Parasitismus ist ein universelles Phänomen im Organismenreich.
Um die parasitäre Lebensweise ausleben zu können, bedarf es besonderer dafür zweckmäßiger Organe. Die parasitäre Lebensweise ist in aller Regel nur durch besondere morphologische, anatomische, physiologische, oft auch durch ethologische (Verhaltens-) Anpassungen möglich. Ektoparasiten besitzen spezielle Mundwerkzeuge (Stechapparate) und Verdauungsorgane, mit denen sie die von ihren Wirten gewonnene Nahrung verwerten; sie benötigen z. T. besondere Organe, um sich am Wirt befestigen zu können (z. B. Klammerfüße bei der Laus, Saugnäpfe beim Blutegel).
Endoparasiten müssen ganz besondere Anforderungen meistern und zeigen noch weit tiefgreifendere Änderungen der Körpergestalt als Ektoparasiten. Sie benötigen geeignete Mechanismen, um in den Wirt eindringen zu können, sie müssen sich im Wirt verankern und dort ausreichend Nahrung aufnehmen können, abwehrenden Wirtsreaktionen (Schutz vor Abwehrkräften und Verdauungssäften des Wirtes) begegnen und Strategien verfolgen, die ihrer Nachkommenschaft eine Übertragung auf andere Wirte ermöglicht. Sie müssen in der Lage sein, ohne Sauerstoff zu leben. Die Bewegungsorgane sind zugunsten von Haftorganen mehr oder weniger stark zurückgebildet, ebenso der Magen-Darm-Kanal zugunsten von Reservestoffen und einer Vergrößerung des Geschlechtsapparates (Endoparasiten müssen eine immense Zahl von Eiern produzieren, damit die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dass durchschnittlich wenigstens zwei oder drei von ihnen wieder einen Wirt infizieren können. Dazu kommt die Fähigkeit zur ungeschlechtlichen Vermehrung. Es ändert sich im Grunde das gesamte Tier. In Extremfällen sind Endoparasiten so stark umgebildet, dass sie geradezu gestaltlos erscheinen.
1.8 Schlussfolgerungen
Die kurze Beispielsammlung zeigt zum einen, wie vielfältig und ausgeklügelt Einrichtungen zum Töten oder Schädigen von Tieren sind. Zum anderen wird auch die Vernetzung solcher Strukturen und Verhaltensweisen in der Ökologie deutlich. Die „Fallsgestaltigkeit“ (s. o.) der heutigen Schöpfung ist tief in die Existenzweise der Lebewesen verwoben. Fallsgestaltige Strukturen sind keine zusätzlichen Mechanismen und Einrichtungen, die zur Ursprungsökologie (ohne Tiernahrung) dazu kommen, sondern verändern diese tiefgreifend.
Autor: Reinhard Junker, 17.05.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2041.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung (Experten)
2.0 Inhalt
In diesem Artikel wird eine große Anzahl von Einrichtungen für den Erwerb und Verzehr tierischer Nahrung, von Räuber-Beute-Beziehungen und parasitären Lebensformen vorgestellt.
2.1 Problemstellung
Eines der Standardargumente gegen ein historisches Verständnis der biblischen Urgeschichte ist das Fressen und Gefressenwerden in der Schöpfung. Es wird wie folgt argumentiert: In 1. Mose 1,29-30 wird geschildert, dass die Tiere und der Mensch nur pflanzliche Nahrung zu sich nehmen sollten: Es wird auch ausdrücklich gesagt, dass es auch so geschah. Heute aber ist das ganz anders. Viele Tiere erbeuten andere Tiere und benötigen dazu häufig ausgeklügelte Werkzeuge und Verhaltensweisen zum Beuteerwerb. Die Beutefangmechanismen sind oft so kompliziert, dass sie nicht durch Mikroevolution |1.3.1.3.1 Mikro- und Makroevolution| entstehen konnten; sie erfordern gegenüber Pflanzenfressern z. T. erhebliche Neukonstruktionen oder gewaltige Umkonstruktionen und damit Makroevolution. Wenn es aber nach den Vorstellungen der Schöpfungslehre keine Makroevolution gibt, wie kommen dann die komplizierten Räuber-Beute-Beziehungen zustande? Sie müssten von vornherein am Anfang der Schöpfung schon dagewesen sein. Das würde aber dem biblischen Schöpfungsbericht (s. o.) widersprechen.
Im Übrigen sei eine Welt ohne Tod und ohne Räuber-Beute-Beziehungen ökologisch gar nicht denkbar. Die biblische Schilderung von einer Welt ohne Tiernahrung sei daher unrealistisch. Sie könne allenfalls bildlich verstanden werden, nicht aber als Beschreibung eines tatsächlichen ursprünglichen Zustandes der Schöpfung.
Im Folgenden werden heutige ökologische Verflechtungen der belebten Welt anhand einiger typischer Beispiele geschildert. Damit soll beispielhaft dokumentiert werden, welche Unterschiede zwischen der uns vertrauten Ökologie und einer ganz andersartigen Urspungsökologie bestehen. Daraus wird ersichtlich werden, dass der Übergang von einer Ursprungsökologie (wie in 1. Mose 1,29-30 angedeutet) zur heutigen Ökologie mit dem Fressen und Gefressenwerden in der Tat nicht durch mikroevolutive, natürliche Vorgänge erklärbar ist.
Im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| wird gezeigt, dass die biblischen Texte tatsächlich eine ursprüngliche Welt ohne Tod in der gesamten Schöpfung beschreiben, und zwar im Sinne einer realistischen Schilderung einer Schöpfung, die ursprünglich wesensmäßig anders gestaltet war als die heutige. Daraus folgt notwendigerweise, dass es einen Übergang oder einen Umbruch in die heutige „Todes-Ökologie“ gegeben haben muss. Einige biblische Texte geben Hinweise darauf, dass dieser Umbruch mit dem Sündenfall des Menschen zu tun hat. Der Sündenfall ist demnach ein für die gesamte Schöpfung einschneidendes Ereignis. Wie man sich einen solchen Übergang oder Umbruch aus biologischer Sicht vorstellen könnte, ist Gegenstand des Artikels |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung|.
2.2 Die ökologischen Verflechtungen
Um die Frage nach den möglichen Folgen des Sündenfalls für die Ökologie der Lebewesen angemessen angehen zu können, soll in diesem Artikel ein Einblick in die heute beobachtbaren Wechselwirkungen zwischen den Organismen gegeben werden. Es geht dabei nicht um eine vollständige Übersicht, sondern um vielseitige Eindrücke von ökologischen Verflechtungen, die mit der Existenz des Todes in der Schöpfung zusammenhängen.
Dabei wird nur auf diejenigen gegenseitigen Abhängigkeiten eingegangen, die Elemente enthalten, die mit dem Tod in der Schöpfung zu tun haben. Wir nennen solche Strukturen „fallsgestaltig“, weil sie hier als Folge des Sündenfalls betrachtet werden. Es geht dabei vor allem (aber nicht nur!) um destruktive Strukturen, die dazu da sind, andere Tiere zu schädigen oder zu töten.
Natürlich entsteht dabei ein einseitiges Bild, denn es gibt ja auch viele Fälle von gegenseitigem Nutzen. Man denke nur etwa an die überaus zahlreichen Beispiele gegenseitiger Abhängigkeiten von Blüte und Insekt bei der Bestäubung, an Anpassungen von Früchten an Tierverbreitung oder an die Darmflora von Mensch und Tieren und viele andere Beispiele von Symbiosen [= Zusammenleben mit gegenseitigem Nutzen]. Es soll in diesem Artikel jedoch darum gehen, negative Wechselwirkungen zwischen Lebewesen darzustellen.
Nahrungsketten. Das Fressen und Gefressen werden ist uns von Kindheit an so geläufig, dass es zu den größten Selbstverständlichkeiten gehört. Viele Tiere überleben nur auf Kosten anderer Tiere. Auch wenn man in Rechnung stellt, dass viele Raubtiere auch mit pflanzlicher Nahrung auskommen (z. B. im Zoo), bleibt doch die Tatsache, dass die Stabilität der heutigen Lebensgemeinschaften von ausgewogenen Räuber-Beute-Verhältnissen abhängt. Ein Ökosystem würde es auf Dauer nicht verkraften, wenn seine Raubtiere auf Pflanzennahrung übergingen. Das Überleben auf Kosten anderer Tiere ist nicht wegzudenken. Des einen Räuber ist dabei fast ausnahmslos des anderen Beute, das Resultat daraus sind Nahrungsketten. Abb. 123 zeigt vereinfacht eine solche Nahrungskette (bzw. ein Nahrungsnetz). Im Meer sieht eine typische Nahrungskette etwa folgendermaßen aus: Das Phytoplankton (Algen) wird von Zooplankton (z. B. kleine Krebse) gefressen, dieses wiederum von sogenannten Friedfischen, welche von Raubfischen gefressen werden. Am Ende der Kette steht z. B. der Mensch.
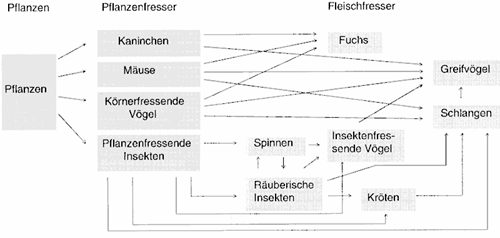
Abb. 123: Beispiel eines Nahrungsnetzes. Die Organismen hängen in einem komplexen Netz von Fressen und Gefressenwerden miteinander zusammen, hier dargestellt am Beispiel von Nahrungsketten in einem Waldrandgebüsch. Durch die Querverbindungen gibt es ein Nahrungsnetz.
Die Räuber-Beute-Beziehungen sind jedoch nicht einfacher, linearer Art, vielmehr schlägt ein Räuber in der Regel viele Beutetierarten und eine Beutetierart hat viele Fressfeinde. Daraus resultiert ein kompliziertes Netz von Räuber-Beute-Beziehungen. So umfasst das Nahrungsspektrum des Löwen etwa zwanzig Huftierarten und gelegentlich noch weitere Tierformen, die alle auch bei anderen Beutetieren auf dem Speisezettel stehen. Wanderfalken sollen über 120 Vogelarten erbeuten. Die komplexen Nahrungsbeziehungen werden bislang meist nur in Aspekten durchschaut. Dies zeigt sich an den z. T. unangenehmen Überraschungen, die es immer wieder bei Verschleppung von Arten in fremde Biotope gibt. Allerdings sind Ökosysteme auch in Grenzen flexibel, und auch nach Katastrophen stellen sich neue Gleichgewichte ein.
So paradox es klingen mag: die Beutetiere sind auf die Räuber angewiesen, wollen sie als Art überleben, denn ihre Populationen würden bei Abwesenheit des Räubers überhand nehmen und sich dadurch selbst die Nahrungsgrundlage entziehen; außerdem könnten sich Krankheiten seuchenhaft ausbreiten und die Population gefährden. Räuber fungieren oft auch als „Gesundheitspolizisten“, indem sie kranke, schwache oder in irgendeiner Weise abnorme Individuen eher schlagen (können) als gesunde und kräftige. In dieser Hinsicht hilft der Räuber der Beute als Population. Die Strategien von Räuber und Beute sind also so abgestimmt, dass das Überleben beider unter normalen Bedingungen nicht gefährdet wird.
Auch die Abbauprodukte toter Organismen werden von Organismen genutzt und bilden daher einen wichtigen Bestandteil im Haushalt der Natur.
2.3 Strukturen und Verhaltensweisen für den Beuteerwerb
Damit Tiere andere erbeuten und verzehren können, benötigen sie passende Körperstrukturen und Verhaltensweisen: Der Räuber muss seine Beute erkennen, überwältigen, verzehren und verdauen können. Im Folgenden soll eine Auswahl von Beispielen solcher Strukturen und Verhaltensweisen geschildert werden. Es handelt sich dabei um Strukturen und Verhaltensweisen, die in einer Welt, wo den Tieren das „grüne Kraut“ zur Nahrung gegeben ist (1. Mose 1,30) sinnlos wären (= fallsgestaltige Strukturen, s. o.). Die Liste von Beispielen wird bewusst nicht kurz gehalten, damit ein breiter Eindruck von der Vielfalt des Fallsgestaltigen im Tier- und Pflanzenreich vermittelt werden kann. Dabei beschränken wir uns zunächst auf Beschreibungen. Überlegungen, inwieweit diese fallsgestaltigen Merkmale im Laufe einer Mikroevolution nach der Erschaffung der Arten erworben werden konnten, werden im Artikel |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung| diskutiert. Man beachte beim Lesen der Beispiele, dass die Körperstrukturen und Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt sein müssen, damit Beutesuche, -fang und -verzehr erfolgreich sind. Die nachfolgenden Beispiele stammen meist aus Schröpel (1986).
Strukturen und Verhaltensweisen, die den Nahrungserwerb ermöglichen. Um die Beute fangen zu können, bedarf es geeigneter Verhaltensweisen und Organe. Beides muss aufeinander abgestimmt sein.
Zum Reißen und ggf. Kauen der Beute benötigen Tiere ein geeignetes Gebiss, ein „Raubtiergebiss“ (bei Wirbeltieren), kauend-beißende Mundwerkzeuge (bei Insekten) usw. Ein Raubtiergebiss unterscheidet sich von einem Grasfressergebiss stark; man vergleiche etwa das Gebiss eines Huftieres mit dem eines Raubtieres (s. Abb. 124). Auch wenn man mit einem Raubtiergebiss auch pflanzliche Nahrung zu sich nehmen kann, so ist es dafür doch nicht so gut geeignet und nicht dafür konstruiert.

Abb. 124: Fleisch- und Pflanzenfressergebiss. Fleischfressergebiss (Löwe; oben) und Pflanzenfressergebiss (Pferd; unten).
Neben geeigneten Beutefangorganen ist auch ein geeignetes Beutefangverhalten erforderlich. Ein Räuber muss sich anders verhalten als ein Pflanzenfresser.
Was die physiologische Seite betrifft, so ist tierische Nahrung leichter verdaulich als Pflanzennahrung. Ein Pflanzenköstler verträgt in der Regel auch tierische Nahrung.
Beispiele. Bartenwale ernähren sich, obwohl sie die größten heue lebenden Organismen sind, von Kleinlebewesen, hauptsächlich Krillkrebsen, die nicht einmal 10 g schwer sind. Davon benötigt der bis zu 130 t schwere Blauwal (Balaenoptera musculus) ganze Lastkraftwagenladungen. Diese auf den ersten Blick überraschende Nahrungsquelle wäre völlig ungeeignet, wenn die Bartenwale nicht einen geeigneten Filterapparat hätten. Bartenwale besitzen im Maul einen solchen Filterapparat, mit dem sie die Krebse aufnehmen. Am zahnlosen Hornkiefer hängen lange Hornplatten mit seitlichen Fransen in mehreren Reihen herab, die Barten. Mit dem Wasser gelangen die darin sich befindlichen Krebse in die Mundhöhle. Beim Herauspressen des Wassers aus dem Mundhöhlenraum durch die Barten bleibt die Nahrung an den Fransen hängen. Mit der Zunge wird sie durch den schmalen Schlund in den Gaumen befördert.
Die zu den Fangschrecken gehörende Gottesanbeterin (Mantis religiosa) schlägt ihre Beute mit dem zu wirkungsvollen Fanghaken umgebildeten ersten Beinpaar, mit dem sie blitzschnell und zielsicher zuschlägt. Der Fangschlag dauert nur 10-30 Millisekunden. Mit Hilfe von Sinnesborsten, die je nach Kopfdrehung gestaucht werden, kann die Mantis die Lage der Beute relativ zum Kopf bestimmen. Entsprechend wird die Schlagrichtung „eingestellt“. Bis ein geeignetes Beutetier in Reichweite gelangt, wartet das Insekt u. U. mehrere Stunden lang.
Durch Echopeilung mittels Ultraschall und Radar orten Fledermäuse ihre fliegende Beute. Die Fledermäuse können die von der Beute zurückkommenden Schallsignale analysieren, Entfernung und Flugrichtung der Beute bestimmen und ihre eigene Flugrichtung entsprechend einschlagen. Die Ultraschalltöne wären so laut wie ein Presslufthammer, wenn sie im für den Menschen hörbaren Bereich ausgestoßen würden. Die Schreie werden durch den Mund, bei einigen Fledermausfamilien durch die Nase ausgestoßen, wobei das Nasenblatt als eine Art Megaphon dient. Mit Ultraschall arbeiten auch Delphine.
Die mit Möwen verwandten Scherenschnäbel (Rhynchops) fliegen ganz dicht über die Wasseroberfläche flacher Seen und Teiche sowie an Flussufern und an Küstensäumen entlang. Dabei halten sie den Schnabel geöffnet, senken den langen Unterschnabel nach unten, furchen das Wasser und sammeln Beutetiere.
Anlocken der Beute. Manche Tiere gelangen an ihre Beute, indem sie sie anlocken, und verwenden dafür besondere „Lockorgane“. So trägt der Tiefseeanglerfisch Linophryne arborifera eine „Leuchtangel“ an der Oberkieferspitze, mit der Beutefische aus der ansonsten stockdunklen Umgebung angelockt werden. Der das flache Küstenwasser bewohnende Seeteufel (Lophius piscatorius) lockt Fische durch einen als wurmförmigen Köder umgebildeten Rückenflossenstrahl heran und saugt sie dann mit dem riesigen Maul ein. Die meiste Zeit liegt er regungslos auf dem Bodengrund. Struktur und Verhalten passen zusammen, um die Beute in erreichbare Nähe zu bringen und zu erreichen. Auch durch „ausgeklügelte“ Verhaltensweisen kann dieses Ziel erreicht werden. Ein Buntbarsch (Haplochromis livingstonii) aus dem Malawisee in Afrika stellt sich selbst als Leiche dar, die auf Aasverzehrer attraktiv wirkt. Sein Farbmuster verschwindet dabei. Doch wenn ein Fisch etwas von ihm abknabbern will, wird er augenblicklich sehr mobil und fängt ihn.
Finden der Beute. Um Beutetiere ausfindig zu machen, verwenden manche Räuber hochsensible Sinnes-
organe. Klapperschlangen besitzen Temperaturdetektoren. Sie können damit Temperaturunterschiede zwischen der allgemeinen Umgebung und einem wärmeabstrahlenden Objekt feststellen, die nur etwa 0,003oC betragen. Das sprichwörtliche Adlerauge des Steinadlers (Aquila chrysaetos) nimmt noch aus 800 bis 1000 m Entfernung die geringen Bewegungen eines Hasen in der Sasse wahr. Der Mäusebussard (Buteo buteo) soll an der Stelle größter Sehschärfe in der Netzhaut bis achtmal schärfer sehen als der Mensch, also so gut wie der Mensch durch ein achtfach vergrößerndes Fernglas.
Mehrere Suchstrategien können miteinander kombiniert sein: Der Bienenwolf (Philanthus), eine große Grabwespenart, erkennt seine Beute zunächst durch optische Reize, Duftreize führen nach der Annäherung zum Fang und das Stechen erfolgt durch optische Reize und Berührungsreize.
Fangen der Beute. Viele Tierarten fangen ihre Beute gemeinsam durch ein koordiniertes Vorgehen. Ungemein „taktisch klug“ gehen Pelikane vor. Sie finden sich beim Fischfang zu Trupps zusammen. „In einer Linie oder im Halbkreis treiben sie vom tieferen, küstenferneren Wasser Fischschwärme in die seichte Uferregion, indem die Treiberketten durch heftiges Flügelschlagen, Beintreten und Schnabel-ins-Wasser-Stoßen die Fische zur Flucht vor sich her veranlassen. Die oft über hundert Vögel eines solchen Treibens können damit ganze Wasserflächen gegen ein Ausbrechen der Fische absperren. Im flachen Wasser, nahe dem Ufer, ist es für Pelikane nun ein leichtes, aus dem zusammengedrängten Fischschwarm, gewissermaßen aus dem Vollen, zu schöpfen“ (Schröpel 1986).
Der Gepard (Acinonyx jubatus) setzt seine läuferischen Qualitäten ein, um die Beute ergreifen zu können. Er erreicht Spitzenwerte von über 100 km/h, die er allerdings nur über wenige 100 m durchhalten kann. Diese Geschwindigkeit wird durch eine besonders biegsame Wirbelsäule, die Beweglichkeit der Schulterblätter und die langen Beine ermöglicht.
Dass die Räuber besondere Fähigkeiten benötigen, um teilweise gleichgroße Beutetiere überwältigen zu können, muss nicht besonders betont werden. Wenn ein Löwe ein Gnu überwältigt, geht es wirklich blutrünstig zu.
Besonders hinterlistig sind die Fallenapparate der Spinnen. Jedermann geläufig ist das Netz von Radnetzspinnen, in welchem ahnungslose oder unvorsichtige Opfer hängen bleiben. Es gibt eine Unzahl weiterer Vorrichtungen, die mit Fangfäden arbeiten, z. B. Stolperdrähte als Signalüberträger oder Baldachine.
Manche Tiere setzen Geschosse ein. Die Lassospinne (Mastophora) jagt nachts, indem sie einen Faden mit dickem Leimtropfen gegen fliegende Insekten schleudert. Die getroffene Beute bleibt kleben, die Spinne kommt herab und tötet sie. Der Schützenfisch (Toxotes jaculatrix) (s. Abb. 125) spuckt kleine Wassertropfen von der Oberfläche des Wassers auf Insekten, die in der über dem Ufer hängenden Vegetation sitzen. Er trifft auf Entfernungen von über 1 m mit unglaublicher Sicherheit. Die Lichtbrechung und Wellenbewegungen berücksichtigt der Fisch beim Zielen. Die Fähigkeit des Schießens wird durch eine vergleichsweise bewegliche Zunge ermöglicht, die er gegen den Gaumen pressen kann. Im Gaumen liegt eine Rinne, die mit der Zunge zusammen eine Art Blasrohr bildet. Durch kräftiges Schließen der Kiemendeckel wird Wasser aus der Mundhöhle durch die Röhre gepresst.
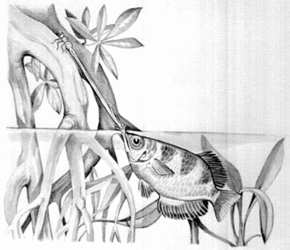
Abb. 125: Der Schützenfisch Toxotes ejaculatrix. Zeichnung: Marion Bernhardt
Die Waffen der Jäger. Krallen und Zähne vieler Räuber sind zweckmäßig konstruierte Tötungswerkzeuge. Die Katzenkrallen können willkürlich eingezogen oder ausgestreckt werden (nicht jedoch beim Gepard). Der Steinadler besitzt kräftige Zehen mit großen Krallen, die Säugetiere töten können.
Der Schwertfisch (Xiphias gladius) besitzt eine weit vorspringende, knöcherne Verlängerung des Oberkiefers, die ihm seinen Namen gegeben hat. „Die Waffe hat die Festigkeit von Elfenbein. Der Schwertfisch schießt wie der Sägefisch mitten in einen Schwarm kleiner Fische und schlägt mit seinem Schwert nach allen Seiten so lange aus, bis Dutzende von Fischen getötet und verstümmelt sind. Erst dann sammelt er sie auf und beginnt mit dem Mahl.
Das Chamäleon (Chamaeleo) fängt seine Beute mit einer langen, ausfahrbaren, klebrigen Zunge (s. Abb. 126). Sie sind ausgesprochen geduldige Lauerer. Bevor die Zunge ausgeschleudert wird, schätzt das Tier die Entfernung zur Beute. Die Zunge wird blitzschnell genauso weit ausgestoßen, dass ihre keulige und vorn eingedellte Verdickung genau die Beute erreicht. Es können Beutetiere erreicht werden, die ca. 1 1/3 mal soweit entfernt sind, wie das Chamäleon lang ist. Das Ausschleudern und Einziehen der Zunge geschieht so schnell, dass dieser Vorgang durch das menschliche Auge nicht beobachtbar ist; der ganze Vorgang dauert nur 0,05 s. Eine ähnliche Zungenwaffe besitzen die Spechte.

Abb. 126: Chamäleon mit herausgeschleuderter Zunge. Höchst gefährlich ist die lange, ausfahrbare Chamäleonzunge. Ihre Spitze ist klebrig und kann Beuteinsekten greifen. Die Zunge wird exakt so weit ausgeschleudert, wie es zum Erfassen der Beute erforderlich ist. Der Ausschleudervorgang ist so schnell, dass er mit bloßem Auge nicht wahrgenommen werden kann. Zeichnung: Marion Bernhardt
Ein weiteres Hilfsmittel zur Tötung der Beute ist Gift und ein dazugehörender Giftapparat als Injektionskanüle. Giftapparate finden sich bei vielen Tierarten unterschiedlicher taxonomischer Stellung. Die ungiftigen Riesenschlangen erwürgen dagegen das Opfer durch Umschlingen mit ihrem muskulösen Körper.
Verzehren der Beute. Schlangen, die ihre Beute verschlingen, besitzen ein kompliziertes Kiefergelenksystem, das ihnen diese Ernährungsweise ermöglicht. Die Unterkieferäste sind nicht fest verwachsen, sondern werden durch ein elastisches Band zusammengehalten. Beim Schlingakt weitet sich dieses Band sehr stark. Damit die Schlange während des Schlingaktes nicht erstickt, wird die Mündung der Luftröhre nach vorn, mitunter sogar seitlich aus dem Mund heraus verschoben. Ist die Beute in der Speiseröhre verschwunden, treiben starke Muskelbewegungen sie zum Magen weiter. Dieses Beispiel macht deutlich, dass praktisch die gesamte Körperkonstruktion der fleischfressenden Ernährungsweise angepasst sein kann, wobei alle Einrichtungen gleichzeitig vorhanden sein müssen.
Um eine gefangene Beute nutzen zu können, muss der Räuber an die nahrhaften Körperteile gelangen. Manchmal ist das gar nicht leicht. So hätten Steinadler nicht viel von erbeuteten Schildkröten, wenn sie es nicht verstünden, ihren Panzer zu knacken. Dazu trägt der Greifvogel die Schildkröten in große Höhe und lässt sie auf einen Felsen fallen, um den Panzer zu Bruch zu bringen. Der aasverzehrende Bartgeier (Gypaetus barbatus) verfährt mit großen Röhrenknochen ebenso, um an das Mark zu gelangen.
Da viele Räuber ihre Fleischnahrung nicht regelmäßig erbeuten können (ein Problem, das sich Pflanzenfressern meist nicht stellt), sind sie darauf angewiesen, sich einen Vorrat zuzulegen. Viele Fleischfresser sind in der Lage, große Beutemengen auf einmal zu verzehren, aber auch längere Zeit zu hungern.
Fleischfressende Pflanzen. Nicht nur Tiere schädigen oder töten einander, es gibt auch eine Reihe von Pflanzen, die von tierischer Nahrung leben, die fleischfressenden Pflanzen. Meist handelt es sich um Arten, die aufgrund ihrer Lebensweise kaum an Mineralstoffe herankommen, z. B. Hochmoorpflanzen oder epiphytisch (z. B. auf Bäumen) lebende Formen. Für diese ungewöhnliche Ernährungsweise benötigen die Pflanzen besondere Strukturen (Fallenorgane), die bei anderer Lebensweise nicht in Ansätzen notwendig wären. Beispiele für fleischfressende Pflanzen aus der einheimischen Flora sind der Sonnentau, das Fettkraut und der Wasserschlauch. Der Sonnentau [s. 127 Abb. 127) besitzt Fangblätter mit Drüsenhaaren, die am Ende kopfig verdickt sind und klebrigen Schleim absondern. Dadurch werden Insekten angelockt, die dann hängen bleiben. Durch Krümmungsbewegungen werden die Insekten vom Blatt und den Drüsenhaaren umschlossen und verdaut (Klebfallen-Prinzip). Das Fettkraut ist mit Verdauungsdrüsen auf der klebrigen Blattoberseite besetzt. Der untergetaucht wachsende Wasserschlauch besitzt kleine Blasen mit einer nach innen öffnenden winzigen Klappe. Kleine gefangene Tiere werden in den Bläschen durch ausgeschiedene Sekrete verdaut.

Abb. 127: Klebrige Blätter und Blütenknospen des Sonnentaus (Drosera).
Am Beispiel der tropischen Kannenpflanze (Nepenthes; s. Abb. 128) soll verdeutlicht werden, dass mehrere Strukturen ausgebildet und aufeinander abgestimmt sein müssen, damit die Nahrungsgewinnung gewährleistet ist. Als Fangapparat dient dieser epiphytisch [= auf anderen Pflanzen ohne Bodenkontakt] lebenden Pflanze ein kannenförmiges Fallenblatt, in welchem sich eine Verdauungsflüssigkeit befindet. Durch den farbigen Deckel und den farbigen Kannenrand werden Insekten angelockt. Der glitschige Kannenrand bringt die gelandeten Insekten zum Abrutschen ins Kanneninnere, wo diese dann verdaut und die Verdauungsprodukte von der Pflanze aufgenommen werden. Die aufgenommenen tierischen Stoffe werden in pflanzliches Eiweiß umgebaut.

Abb. 128: Das Kannenblatt der Kannenpflanze (Nepenthes)
2.4 Strategien der Feindabwehr
Auch zur Feindabwehr bedienen sich viele Beuteorganismen besonderer Strukturen und Verhaltensweisen. Viele Tiere sind durch einen Panzer, durch Stacheln und dergleichen relativ gut, wenn auch nie hundertprozentig, geschützt. Der Rotfeuerfisch (Pterois volitans) hat giftige Rückenflossenstacheln. Kopffüßer stoßen zum Schutz vor Verfolgern eine tarnende Tinte aus. Viele Tiere schrecken ihre Feinde durch Warnfarben ab, andere sondern schlecht schmeckende Sekrete ab.
Um Feinde rechtzeitig zu erkennen, nützt beispielsweise ein großes Gesichtsfeld: Hasen können rundum sehen, ohne den Kopf drehen zu müssen. Gesellig lebende Tiere haben oft eine „Wache“. Andere Tiere setzen auf Tarnung (s. u.).
Geschicktes Verhalten kann auch schützen: Hasen legen blind endigende Spuren um die Sasse herum, um schnüffelnde Hunde zu verwirren. Ameisenigel können sich blitzschnell eingraben. Regenpfeifer stellen sich bei Feindannäherung in Gelegenähe krank, um dem Feind eine sichere Beute vorzutäuschen und dadurch vom Gelege abzulenken.
Manche Beutetiere wehren sich durch Feindbeschuss. Bombardierkäfer spitzen ein ätzendes Sekret aus dem Hinterleib. Durch die Verbindung des enzymatisch abgespaltenen Wasserstoffs mit Luftsauerstoff kommt es zu einer kleinen Knallgasexplosion.
Eine ganz einfache und oft verwirklichte „Gegenwehr“ gegen Feinddruck ist eine hohe Fruchtbarkeit. „Die einzige Möglichkeit, die Wasserflöhen bleibt, um ihre Population zu erhalten, ist nur, sich stärker als alle Raubfeinde zu vermehren“ (Schröpel 1986). Die Nachwuchsrate ist den Verlustraten angepasst, so dass die Bestände der Räuber und Beute auf lange Sicht konstant bleiben. Erhebliche Schwankungen gibt es bemerkenswerterweise sogar innerhalb von Arten, je nachdem, wie zahlreiche Feinde im besiedelten Areal sind.
Tarnung, Mimese und Mimikry. Ein geeignetes Mittel sowohl für Räuber und Beute sind Tarnung, Mimese und Mimikry. Tarnung hilft dem Räuber, nicht vorzeitig von der Beute entdeckt zu werden und umgekehrt. Bekannte Beispiele für Tarnung sind die Streifung von Frischlingen des Wildschweins mit gestaltsauflösender Wirkung oder steinfarbene Eier in Bodengelegen. Umgekehrt passt sich beispielsweise die Veränderliche Krabbenspinne (s. Abb. 129) der Farbe von Blüten an, in denen sie sich versteckt, um auf Beute aufzulauern. Hier dient die Tarnung dem Feind. Diese Krabbenspinne kann in gewissen Grenzen ihre Körperfarbe der Blütenfarbe anpassen.

Abb. 129: Die Veränderliche Krabbenspinne auf einem Blütenkörbchen der Arnika. Die Spinne kann sich farblich dem Untergrund anpassen.
Es gibt auch Tiere, die sich akustisch tarnen. Unter Nachtschmetterlingen senden einige Ultraschall-Laute aus, um die sie mit Hilfe von Ultraschall jagenden Fledermäuse (s. o.) in die Irre zu führen. Außerdem schluckt ihre pelzige Körperfläche den Schall.
Unter Mimese versteht man die Ähnlichkeit mit belebten oder unbelebten Objekten der Umgebung in Form und Farbe. Sie soll mögliche Feinde dadurch fernhalten, dass ein uninteressantes Objekt vorgetäuscht wird. Berühmt hierfür ist das „Wandelnde Blatt“, eine tropische Gespenstheuschrecke, die einem grünen Laubblatt bis auf die Aderung ähnelt (s. Abb. 130). Bei Beunruhigung schwingt das Tier leicht mit dem Körper, wie ein Blatt im Wind. Einige Spannerarten nehmen in der Ruhehaltung die Form eines Zweigstückes an.

Abb. 130: Das Wandelnde Blatt. Zeichnung: Marion Bernhardt
Mimikry liegt vor, wenn die Gestalt eines Tieres von einem anderen Tier nachgeahmt wird. Es gibt verschiedene Formen von Mimikry, sie kann verschiedenen Zwecken dienen. Am bekanntesten ist die Scheinwarntracht. Ein harmloses Tier besitzt eine ähnliche Körperzeichnung wie ein gefährliches oder ungenießbares und täuscht dadurch vor, anders zu sein, als man wirklich ist. Es sind „Schafe im Wolfspelz“ (Batessche Mimikry) (Beispiel: Abb. 131).

Abb. 131: Mimikry am Beispiel des harmlosen Hornissenschwärmers (links), welcher die Hornisse (rechts) nachahmt.
Mimikry kann aber auch zum Anlocken der Beute verwendet werden, wenn ein harmloses Vorbild in Aussehen und Verhalten nachgeahmt wird (Peckhamsche Mimikry). Der Hinterleibsrücken einer Krabbenspinne aus dem tropischen Amerika, Epicadus heterogaster, trägt Hörner, deren Enden rot gefärbt sind und dadurch den Staubgefäßen der Blüten gleichen (Abb. A).

Abb. A: Epicadus heterogaster (Wikimedia: Alex Popovkin, Bahia, Brazil, CC BY 2.0)
„Kampf ums Dasein“. Mit dem „Kampf ums Dasein“ ist nicht in erster Linie blutrünstiger Überlebenskampf gemeint, sondern die Tatsache, dass nur ein (manchmal verschwindend kleiner) Teil der Nachkommenschaft einer Generation zur Fortpflanzung kommt, der Rest hingegen vorzeitig stirbt. Daraus resultiert eine Auslese (natürliche Selektion), die biologisch sinnvoll ist, weil in der Regel Individuen mit genetischen Defekten und irgendwelchen Nachteilen an der Fortpflanzung gehindert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Genpool (das ist die Summe aller Erbfaktoren einer Art) nicht nach und nach verdirbt, d. h. mit ungünstigen Allelen (Genzustandsformen) angereichert wird. Auf Dauer könnte wegen der ständig auftretenden fast immer schädlichen Mutationen (Erbänderungen) kaum eine Population ohne Selektion überleben. Die Strategie „Überproduktion – Selektion“ ist unter Mutationsdruck unentbehrlich.
Territorialverhalten. Fressen und Gefressenwerden dienen u. a. der Dichteregulation. Ein Biotop kann nicht unbegrenzt Lebewesen aufnehmen. Ein durch Überbevölkerung hervorgerufener Kollaps wird auch dadurch vermieden, dass Individuen bzw. Pärchen ein Territorium verteidigen, dessen Größe je nach der benötigten Beutemenge und nach der Besiedelungsdichte der Beutetiere festgelegt wird. Individuen, die sich auf der Suche nach einem Territorium nicht gegen arteigene Konkurrenten durchsetzen können, bleiben ohne Nachkommenschaft.
2.5 Krankheit, Missbildungen, Tod
Ein weiterer Komplex biologischer Realität ist das Phänomen „Krankheit“. Praktisch alle Funktionen des Organismus können gestört werden, was im Extremfall den Tod zur Folge haben kann. Auf solche Störungen ist der Körper mehr oder weniger vorbereitet. So kann der Körper mit Hilfe seines Immunsystems Infektionsabwehrmaßnahmen durchführen. Eingedrungene gefährliche Substanzen können z. T. entgiftet oder vernichtet werden, entstandene Schäden können behoben werden (z. B. durch die Bildung einer Narbe). Durch Fieber wird die Stoffwechselintensität erhöht, was den Heilungsprozess fördert. Die Erhöhung der Körpertemperatur muss von einem Sollwertgeber ausgelöst werden. Die Körpertemperatur wird durch einen Regelkreis geregelt.
Tod. Ein Grundsatz der Evolutionslehre könnte lauten: „Ohne Tod kein Leben.“ Tatsächlich gab der Paläontologe H. K. Erben einem seiner Bücher den Titel „Leben heißt Sterben“. Die heutige Ökologie ist in der Tat ohne Tod der Individuen, auch ohne vorzeitigen Tod (meist) der Mehrzahl der Nachkommen eines Elternpaars undenkbar, da andernfalls der vorhandene Lebensraum in kürzester Zeit überfüllt wäre. Die Grenzen des Lebensraums machen das Sterben unumgänglich. Gewöhnlich sterben die Organismen durch Räuber oder Parasiten; der Alterstod ist eher die Ausnahme.
2.6 Viren
Zahlreiche Krankheiten von Mensch, Tier und Pflanzen werden durch Viren hervorgerufen. Zu ihnen zählen Krankheiten wie der relativ harmlose Schnupfen als auch so gefährliche und zerstörerische Krankheiten wie Pocken, Tollwut, Kinderlähmung und AIDS. Viren sind so klein, dass sie nur im Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden können. Sie bestehen aus genetischem Material (DNS oder RNS), das von einer Proteinhülle umgeben ist. Ob man sie als Lebewesen ansehen möchte, ist Definitionssache. Jedenfalls können sich Viren nur mit Hilfe des Stoffwechsels fremder Zellen vermehren. Dabei werden die Wirtszellen zerstört. Viren können auch zellkernlose Prokaryonten (Bakterien und Blaualgen) befallen; man nennt sie dann Phagen. Die Wirkungsweise mancher Viren ist so „ausgeklügelt“, dass Portmann im Falle des Tollwutvirus die Kennzeichnung „dämonisch“ für angemessen hält.
2.7 Parasitismus
Als besonders auffällig „fallsgestaltig“ muss weiter die parasitäre Lebensweise genannt werden. Parasiten sind Lebewesen, die zeitweise oder ständig, ganz oder zum Teil auf Kosten eines anderen, in der Regel größeren Organismus, des sog. Wirtes, leben. Sie beziehen von ihm Nahrung, unter Umständen auch Wohnung oder ähnlichen Nutzen und töten ihn normalerweise nicht oder nicht sofort.
Man unterscheidet Ektoparasiten, die die Körperoberfläche des Wirtes kurzzeitig (z. B. Stechfliegen) oder bis zu lebenslang (z. B. Wanzen) besiedeln, und Endoparasiten, die im Innern des Wirtes leben (z. B. Bandwürmer).
Parasiten finden sich in fast allen Tierklassen, und faktisch alle Wirbeltierorgane können von Parasiten aufgesucht werden. Ein ganz erheblicher Teil der Tiere lebt parasitisch. In manchen Gegenden der Erde sind fast alle Menschen von Wurmparasiten befallen, oft sogar von mehreren Arten. Man kennt alle Übergänge von scheinbar folgenlosem Nebeneinander beider Partner bis zum extrem einseitiger Schädigung. Parasitismus ist ein universelles Phänomen im Organismenreich.
Um die parasitäre Lebensweise ausleben zu können, bedarf es besonderer dafür zweckmäßiger Organe. Die parasitäre Lebensweise ist in aller Regel nur durch besondere morphologische, anatomische, physiologische, oft auch durch ethologische (Verhaltens-) Anpassungen möglich. Ektoparasiten besitzen spezielle Mundwerkzeuge (Stechapparate) und Verdauungsorgane, mit denen sie die von ihren Wirten gewonnene Nahrung verwerten; sie benötigen z. T. besondere Organe, um sich am Wirt befestigen zu können (z. B. Klammerfüße bei der Laus, Saugnäpfe beim Blutegel); dazu kann eine Abplattung des Körpers kommen. Blutsaugende Ektoparasiten benötigen einen sehr dehnbaren Magen-Darmkanal und Speicherräume.
Endoparasiten müssen ganz besondere Anforderungen meistern und zeigen noch weit tiefgreifendere Änderungen der Körpergestalt als Ektoparasiten. Sie benötigen geeignete Invasionsmechanismen, müssen sich im Wirt verankern können und dort ausreichend Nahrung aufnehmen können, abwehrenden Wirtsreaktionen (Schutz vor Abwehrkräften und Verdauungssäften des Wirtes) begegnen und Strategien verfolgen, die ihrer Nachkommenschaft eine Übertragung auf andere Wirte ermöglicht. Sie müssen in der Lage sein, ohne Sauerstoff zu leben. Die Bewegungsorgane sind zugunsten von Haftorganen mehr oder weniger stark zurückgebildet, ebenso der Magen-Darm-Kanal zugunsten von Reservestoffen und einer Vergrößerung des Geschlechtsapparates (Endoparasiten müssen eine immense Zahl von Eiern produzieren, damit die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dass durchschnittlich wenigstens zwei oder drei von ihnen wieder einen Wirt infizieren können. Dazu kommt die Fähigkeit zur ungeschlechtlichen Vermehrung. Es ändert sich im Grunde das gesamte Tier. In Extremfällen sind Endoparasiten so stark umgebildet, dass sie geradezu gestaltlos erscheinen.
Die Entwicklung von Parasiten geht selten direkte Wege (Aufnahme durch den Mund – Magen – Kot – Aufnahme usw.). Oft wandern die eingedrungenen Tiere einige Stationen durch den Wirtskörper, bis sie sich an einer bestimmten Stelle festsetzen. Viele Parasiten befallen mehrere Wirtsarten, wobei der Wirtswechsel oft obligatorisch ist, damit bestimmte Entwicklungsstadien (meist Larven- oder Jugendstadien) durchlaufen werden können. Man spricht dann von Zwischenwirten und dem Endwirt (in welchem die Parasiten geschlechtsreif werden).
Beispiele. Die Beine der ektoparasitischen, von Blut lebenden Kopflaus des Menschen (Pediculus humanus capitis) sind hakenförmig gebaut, so dass sie in idealer Weise die menschlichen Haare umgreifen können und so den nötigen Halt finden. Die Mundwerkzeuge sind der parasitären Lebensweise entsprechend gestaltet und zur Blutaufnahme geeignet. „Die zum Mundkegel umgebildete Kopfspitze ist vorstülpbar und trägt einen Hakenkranz, der mit 5 Paar Häkchen ausgerüstet den Eingang zur Stachelscheide umgibt. Vor dem Stechakt wird die Hornschicht der Oberhaut durch besondere Chitinscheiden beißend und raspelnd beseitigt. Vor dem eigentlichen Stich werden die vorgestülpten Häkchen auf die Haut aufgesetzt. Zwischen ihnen dringt der Stachel in die Haut ein“ (Piekarski 1954, 534f.).
Die Eier (Nissen) der Kopflaus werden mit einem wasserunlöslichen Kitt an die Haare geheftet, so dass normales Waschen sie nicht ablöst (Spezialshampoos helfen jedoch) und nur mechanisches Entfernen möglich ist. Es wird deutlich, dass spezielle Organe und Eigenschaften notwendig sind, damit dieser Organismus parasitär leben kann.
Noch viel mehr ist dies der Fall bei Endoparasiten. Die für diese Lebensweise notwendige Körperstrukturen und Fähigkeiten wurden oben bereits zusammengestellt. Anhand zweier Beispiele soll gezeigt werden, welche z. T. erstaunlichen Wege im Wirtsorganismus bzw. von den Zwischenwirten zum Hauptwirt gegangen werden müssen, damit der Entwicklungszyklus vollständig durchlaufen werden kann.
Trichine (Trichinella spiralis). Die Trichinen werden durch Fleischgenuss aufgenommen. Nach der Begattung im Darm sterben die Männchen bald ab, während die Weibchen in die Darmwand bis zu den Lymphsinus eindringen, wo sie ihre Jungen ablegen. Diese (etwa 100 µ langen und 6 µ breiten) Jungtrichinen gelangen mit dem Lymphstrom passiv in den Blutkreislauf und über Herz, Lunge und wieder Herz mit dem arteriellen Blutstrom in alle Organe, bevorzugen aber die quergestreifte Muskulatur, wo sie die Blutbahn verlassen und aktiv in die Muskelfasern eindringen. Für diesen Weg benötigen die Larven etwa 2-3 Tage. Die Muskelfasern werden durch den Parasiten charakteristisch verändert (sie verlieren ihre Querstreifung), und der Wirtsorganismus scheidet um die noch bewegliche Trichine ein Rohr ab, das sich bei Aufrollen des zur Ruhe gelangenden Parasiten bauchig ausbuchtet. Nach einigen Wochen entsteht daraus eine geschlossene zitronenförmige Kapsel. Mehrere Monate später verkalkt die Kapsel. In dieser Kapsel kann die Trichine beim Menschen bis zu 30 Jahre lebensfähig bleiben. Eine Weiterentwicklung findet nur statt, wenn die Larve in einen neuen Wirt gelangt. Werden die Trichinenlarven mit roher Muskulatur verzehrt, so löst der Magensaft die Kapsel auf und befreit die Trichine. Bis zur Geschlechtsreife können die Trichinen erhebliche Zerstörungen an den Zotten der Darmwand herbeiführen.
Geradezu unglaubliche Anpassungen an die parasitäre Lebensweise besitzt der Kleine Leberegel. Illies (1967, S. 113) schildert anschaulich: „Die Eier dieses Leberwurms des Schafes gelangen mit dem Darminhalt zu vielen Tauenden nach außen. Sie ruhen dort auf der Weide und am Straßenrand, überleben den allmählichen Zerfall des Kotes und vergehen schließlich selbst bis auf die wenigen, vom Glück erwählten, die von einer Ameise gefressen werden. Aus ihnen schlüpft dann im Körper der Ameise eine Wurmlarve, die sich von Körpersäften ernährt und schließlich in etwa 50 Tochterlarven teilt. Diese Tochterlarven wandern in den Hinterleib ihres Wirtes und verkapseln sich dort zwischen den Organen. Eine von ihnen aber wandert in das Gehirn der Ameise, weiß dort eine bestimmte Stelle zu finden und setzt sich hier zur Ruhe. Die Wirkung auf die Ameise ist frappant: sie wird geisteskrank, gibt ihr geregeltes Leben auf, verlässt ihren Staat und klettert an einem Grashalm empor. Dort an der Spitze angelangt, beißt sie sich mit ihren Kiefern fest und streckt den Hinterleib weit von sich waagerecht in die Luft. Den ganzen Tag verhaart sie in dieser Stellung und klettert erst im Abenddämmern wieder nach unten, um das gleiche am nächsten Morgen zu wiederholen. Wird ein solcher Grashalm mitsamt der Ameise von einem Schaf gefressen, so werden die Wurmlarven im Ameisenkörper frei und können die Wanderung in die Leber des Schafes antreten.“
Ähnlich frappierend ist die Leistung der winzigen Schlupfwespen, die ihre Eier in die Puppen anderer Insekten ablegen. Dabei wird der Wirt zunächst nicht getötet, sondern mit einem treffsicheren Stich nur gelähmt. Der schlüpfenden Brut wird so für die gesamte Zeit ihrer Entwicklung frische Nahrung garantiert. Erst kurz vor dem Schlüpfen stirbt der fast völlig ausgefressene Wirt. Man spricht hier von Brutparasitismus, der streng genommen kein echter Parasitismus ist, weil der Wirt immer getötet wird.
Parasiten können ihrerseits wieder in einem Parasiten leben: Hyperparasitismus. So kann es geschehen, „dass aus einer Schmetterlingspuppe nicht der Falter schlüpft, aber auch nicht die 20-30 Parasitenwespen, die als Larven im Körper der Raupe schmarotzten, sondern dass aus der Puppenhülle Hunderte von winzigen ‘Überparasiten’ schwärmen, Schlupfwespen, die als Parasiten in den Parasiten der Raupen lebten!“ (Illies 1967, 112)
Abwehrreaktionen des Wirtes. Wirtsorganismen sind nicht immer dem Parasiten hilflos ausgeliefert. Parasiten können durch wandernde Zellen eingeschlossen, abgekapselt und auch zum Absterben gebracht werden. U. U. werden außerordentlich starkwandige Hüllen gebildet. Der Wirtsorganismus kann sich außerdem durch Antikörperbildung wehren.
2.8 Rückbildungserscheinungen und Aussterben
Eine Reihe von Lebewesen zeigt Rückbildungserscheinungen: Organe sind in ihrer Funktionstüchtigkeit eingeschränkt. Normalerweise werden solche Individuen ausgemerzt, weil sie in der Regel nicht zur Fortpflanzung kommen. Unter speziellen Umweltbedingungen können sind Rückbildungen jedoch tolerierbar. So hat eine Reihe von Höhlentieren ihre Sehfähigkeit teilweise oder ganz eingebüßt (s. Abb. 74). Dort kommen sie auch ohne dieses Sinnesorgan aus. Viele Insekten und Vögel haben rückgebildete Flügel. Sie haben dennoch überlebt, weil es dort weniger Feinde gibt als auf dem Festland. Die Inselfauna bietet zahlreiche Beispiele von Verlusten aufgrund besonderer Anpassungen. So gibt es beispielsweise Schildkröten, die nicht mehr in der Lage sind, sich ganz in ihren Panzer zurückzuziehen, wie das ihre nahen Verwandten auf dem Festland können.
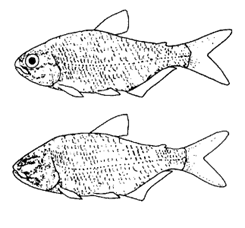
Abb. 74: Flussfisch Astyanax mexicanus und die blinde Höhlenform. Beide gehören zur selben Biospezies.
Artentod (Aussterben). Schließlich muss auch der Artentod genannt werden. Ständig sterben Arten aus, deren genetische Information damit unwiederbringlich verlorengeht. Im Rahmen der Evolutionslehre ist der Artentod ebenso wie der individuelle Tod notwendige Voraussetzung für die Höherentwicklung.
2.9 Sonstige Phänomene, die möglicherweise nicht ursprünglich sind
Kopulationsattrapen. Eine Reihe von Pflanzen täuscht ihren Bestäubern vor, Paarungspartner zu sein. Sie imitieren durch Form der Blüte oder von Blütenteilen, durch Duft und Behaarung bestimmte Insekten, um dadurch Besucher anzulocken, die die Blüte bestäuben sollen. Die Besucher halten die Blüte für einen Artgenossen und versuchen intensiv, aber vergeblich, ihn zu begatten. Dabei werden sie mit Pollen versehen, den sie dann zur nächsten Blüte tragen, durch die sie wieder getäuscht werden. Bekanntestes Beispiel für solche Kopulationsatrappen sind die heimischen Ragwurz-Orchideen (s. Abb. 132), deren Blütenunterlippen Bienen-, Hummeln-, Fliegen- oder Spinnenkörpern ähneln.

Abb. 132: Die Fliegenragwurz (Ophrys insectifera) ist eine der Orchideen, die mit ihrer Blütenunterlippe Insekten im Erscheinungsbild, in der Behaarung und im Duft nachahmt.
Insektenhormone in Pflanzen. Es gibt Substanzen in Pflanzen, die eine Metamorphose [= Umwandlung von Larve in Insekt] von auf ihnen lebenden Insekten verhindern. Diese Substanzen gleichen Häutungshormonen dieser Insekten. Durch die Wirkung dieser Substanzen werden die Insekten also daran gehindert, geschlechtsreif zu werden (wozu die Metamorphose erforderlich wäre). Die Insekten häuten sich öfter als unter normalen Bedingungen, werden dadurch abnorm und sterben ab, ohne Nachkommen hervorgebracht zu haben. Auf diese Weise können sich manche Pflanzen Schaden durch diese Insekten verringern.
2.10 Schlussfolgerungen
Die umfangreiche Beispielsammlung zeigt zum einen, wie vielfältig und ausgeklügelt Einrichtungen zum Töten oder Schädigen von Tieren sind. Zum anderen wird auch die Vernetzung solcher Strukturen und Verhaltensweisen in der Ökologie deutlich. Die „Fallsgestaltigkeit“ (s. o.) der heutigen Schöpfung ist tief in die Existenzweise der Lebewesen verwoben. Fallsgestaltige Strukturen sind keine zusätzlichen Mechanismen und Einrichtungen, die zur Ursprungsökologie (ohne Tiernahrung) dazu kommen, sondern diese tiefgreifend betreffen.
2.11 Literatur
Illies J (1967) Adams Handwerk. Betrachtungen eines Biologen. Hamburg.
Piekarski G (1954) Lehrbuch der Parasitologie. Berlin.
Schröpel M (1986) Räuber und Beute. Landbuch-Verlag.
Autor: Reinhard Junker, 17.05.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/e2041.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen (Interessierte)
Die Bibel schildert die heutige Schöpfung mit recht pessimistischen Worten: Die Schöpfung seufzt, ist von Schmerzen gezeichnet und durch Vergänglichkeit geknechtet. Es wird ein Unterschied zwischen dem heutigen und dem Ursprungszustand gemacht: Die „Knechtschaft der Vergänglichkeit“ begann demnach erst nach einer „Unterwerfung“, durch die auch der Tod in die Schöpfung hineinkam. Ebenso wird es zukünftig eine ganz andere neue Schöpfung ohne Tod durch Gottes Eingreifen geben.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel werden einige biblische Texte ausgelegt, die den gegenwärtigen Zustand der Schöpfung thematisieren und Hinweise darauf geben, wie es zur heutigen „Knechtschaft“ (Römer 8,20) der Schöpfung gekommen ist.
1.1 Problemstellung
Im Artikel |0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung| wurde anhand zahlreicher Beispiele die auf Fressen und Gefressenwerden angelegte Ökologie der uns vertrauten Schöpfung demonstriert. Die ökologischen Kreisläufe basieren auf gegenseitigem Verzehr der Organismen. Dazu verfügen die Lebewesen über Strukturen und Verhaltensweisen, die ihnen das Jagen, Fangen, Verzehren und Verwerten tierischer Nahrung ermöglichen.
In diesem Artikel soll aufgezeigt werden, was die Heilige Schrift zu dieser destruktiven Seite der Schöpfung sagt. Wir nennen dieses „Gesicht“ der Schöpfung „fallsgestaltig“, weil es (wie gezeigt wird) aus biblischer Sicht mit dem Sündenfall zu tun hat. Wir werden dazu zwei Aspekte kennenlernen:
- Die Bibel zeichnet zwei sehr gegensätzliche „Gesichter“ der Schöpfung, neben dem schönen und angenehmen auch ein hässliches fallsgestaltiges.
- Die Bibel erklärt, dass die destruktive Seite nicht von Anfang an zur Schöpfung gehörte, sondern erst nachträglich in sie eindrang. Dies soll im Folgenden anhand einiger biblischer Texte gezeigt werden. Im Artikel |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung| werden Denkhilfen gegeben, wie man sich einen Umbruch von einer Welt ohne Tod in die heutige vom Tod gekennzeichneten Welt vorstellen könnte.
1.2 Was sagt die Schrift zur heutigen Schöpfung?
Was sagt die Bibel zur uns vertrauten Ökologie, die auf Fressen und Gefressenwerden basiert? Im Neuen Testament findet sich dazu im 8. Kapitel des Römerbriefs (Verse 19-22) ein aufschlussreicher Text. Er soll zunächst in der Übersetzung nach Menge wiedergegeben werden:
Römer 8 (19) Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. (20) Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf Hoffnung hin, (21) dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. (22) Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt.
Der Text erklärt, dass die heutige Schöpfung sich vom ursprünglichen Zustand unterscheidet: die Schöpfung wurde der Nichtigkeit bzw. Vergänglichkeit unterworfen; sie war also früher anders. Damit wird ein früherer herrlicher Zustand der Ursprungswelt vorausgesetzt.
Mit „Schöpfung“ (griech. ktisis) ist die gesamte außermenschliche Schöpfung gemeint. Es wird nämlich ausdrücklich gesagt, dass die gesamte Schöpfung seufzt (V. 20 und 22). Wenn die Menschen gemeint wären, sollte man einen anderen Begriff erwarten. Weiter wird gesagt, dass die ktisis ohne ihren Willen unterworfen wurde, also nicht schuldhaft, was sonst in der Heiligen Schrift von den Menschen ja gerade nicht gesagt wird. Das passt nur zur außermenschlichen Schöpfung.
Wie wird die Schöpfung beschrieben? Die Schöpfung wird als „nichtig“ bzw. „vergänglich“ charakterisiert; Dies steht betont am Anfang des Satzes von V. 20. Weiter wird die Schöpfung als seufzend, geknechtet und mit Schmerzen gezeichnet beschrieben. Die „Knechtschaft der Vergänglichkeit“ wird in einen Gegensatz zur Herrlichkeit der Söhne Gottes gestellt. Von der Schöpfung als Ganze wird also ein ausgeprägt pessimistisches Bild gezeichnet. Von daher ist schon klar, dass diese Existenzweise der Schöpfung nicht die ursprüngliche sein kann, wie sie aus Gottes Schöpferhänden kam. Gott hat am Anfang keine seufzende, geknechtete, der Vergänglichkeit unterworfene Schöpfung ins Dasein gebracht.
Wie kam es zur „Knechtschaft der Vergänglichkeit“? Auch zu dieser Frage gibt der Text aufschlussreiche Hinweise. Der Text sagt, dass der gegenwärtige „Status“ durch eine „Unterwerfung“ in Kraft getreten ist. Der Unterwerfer kann nur Gott sein, denn nur er kann auf Hoffnung unterwerfen. Vor dem Hintergrund anderer biblischer Aussagen wird man freilich auch sagen müssen, dass der Widersacher Gottes, der Satan, seine Hand irgendwie im Spiel hatte, doch er hat nur den von Gott eingeräumten Spielraum. (Wir stehen hier vor der sog. Theodizee-Frage, der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leides in der Welt, vgl. dazu Artikel |0.5.2.4 Die Theodizee-Frage|.) Der Aspekt, dass auf Hoffnung hin unterworfen wurde, zeigt, dass Gott der eigentlich Handelnde ist.
Das Verhängnis des Unterworfenseins unter die Knechtschaft der Vergänglichkeit gilt nicht grundsätzlich, sondern es kennt einen Anfang und ein Ende. Das wird durch die Verwendung der (nur im Griechischen vorhandenen) Zeitform des Aorists ausgedrückt, der einen diesem Ereignis vorausgehenden Zustand voraussetzt, in welchem die Schöpfung nicht unter diesem Verhängnis stand.
Aus Römer 8,19ff. geht also hervor, dass die Schöpfung ursprünglich wesensmäßig anders beschaffen war als heute. Sie wurde der Vergänglichkeit unterworfen und besaß somit ursprünglich dieses Merkmal nicht. Folglich hatte sie andere Eigenschaften, die allerdings unserem Vorstellungsvermögen entzogen sind. Das gilt umgekehrt genauso für die verheißene zukünftige Schöpfung.
Die Schöpfung wurde „ohne ihren Willen“ unterworfen, also nicht schuldhaft. Das weist auf den Menschen als Auslöser hin. Damit wird nahegelegt, dass das Unterworfensein Folge des Sündenfalls des Menschen ist und somit erst nachträglich die Schöpfung kennzeichnet. Nicht von ungefähr verstehen viele Ausleger diese Passage als neutestamentliche Auslegung der Sündenfallerzählung (1. Mose 3).
Die Zukunft der Schöpfung. Glücklicherweise bleibt der Text nicht bei der Diagnose und der Ursachenforschung stehen, sondern gibt auch eine Perspektive. Es wird eine neue Schöpfung geben, in der es keine Vergänglichkeit und das mit ihr verbundene Seufzen und Geknechtetsein mehr geben wird. (Das bezeugt die Bibel auch an anderen Stellen.) Der Weg dahin wird als Befreiung und als Neugeburt beschrieben. Es ist klar, dass dies nur durch das Eingreifen Gottes geschehen wird.
1.3 Weitere Texte im Neuen und Alten Testament
In Römer 5,12-19 stellt Paulus einen bestimmten Menschen – Adam – Jesus Christus gegenüber. Beide entsprechen einander in gewissem Sinne: Adam ist der Stammvater der Menschheit wie Jesus der „Anfänger einer neuen Menschheit“ (Paul Althaus) ist:
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist, und durch die Sünde der Tod …
Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung. (Röm. 5,12+18)
In unserem Zusammenhang ist hier bedeutsam, dass die Sünde des Adam den Tod aller Menschen nach sich zog. Dass durch die Tat eines einzigen der Tod in die Welt kam, wird durch die Gegenüberstellung zu dem einen, Jesus Christus, hervorgehoben. Wie Jesus eine bestimmte Person ist, die als Jesus aus Nazareth auf dieser Erde gelebt hat, so war es auch Adam. Somit bezeugt Paulus mit diesen Sätzen in Römer 5, dass eine historische Person das Einfallstor des Todes in diese Welt war. Nach diesem Zeugnis kann also der Tod nicht als ursprünglich angesehen werden. (Mehr dazu im Artikel |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament|.)
Zudem wird der Tod als der „letzte Feind“ Gottes bezeichnet (1. Kor. 15,26), der besiegt werden wird. Dies macht ebenfalls deutlich, dass der Tod nicht zur ursprünglichen Schöpfung gehört.
Jesu Taten. Die Krankenheilungen und Totenauferweckungen Jesu verdeutlichen ebenfalls, dass Krankheit, Leid und Tod Eindringlinge sind, die nicht zur guten Schöpfung Gottes gehören, sondern als Gerichtszeichen zu werten sind. Jesus drängt Krankheit und Tod durch seine Machtworte zurück.
Texte aus der Genesis. 1. Mose 1,29 und 30 geben Auskunft über die Art der Nahrung. Sowohl den Tieren als auch den Menschen wird pflanzliche Nahrung zugewiesen. Tiere sollten also nicht durch Räuber oder Parasiten sterben. Wären sie überhaupt gestorben, wenn es nicht zum Sündenfall gekommen wäre? Dazu wird im Text nichts ausdrücklich gesagt. Dennoch wird man im Anschluss an Röm 5 und 8,19ff. (s. o.) annehmen müssen, dass auch das Sterben der Tiere Ausdruck des „Unterworfenseins“ und des Seufzens der gesamten Schöpfung ist, vgl. die obigen Darlegungen. (Vgl. auch Artikel |0.2.1.1 Die biblische Urgeschichte – wirkliche Geschichte|.)
Besonders bedeutsam ist weiter 1. Mose 3,16-19, die Fluchworte Gottes als Reaktion auf den Ungehorsam und Unglauben von Adam und Eva. Hier werden einige Hinweise dafür gegeben, dass mit dem Sündenfall Umbrüche und einschneidende Veränderungen auch im physikalisch-chemischen und biologischen Bereich einhergingen (Mühsal der Frau in der Schwangerschaft und bei der Geburt, Verfluchung des Ackers – um des Menschen willen, V. 17). Hier wurde die Außenwelt verändert. Es wird deutlich, dass die Konsequenzen des Falls nicht auf die Innenwelt des Menschen beschränkt werden können.
Die knappen Hinweise aus diesem 3. Kapitel des Genesisbuches sind insofern bedeutungsvoll, als sie eine Ahnung davon geben, dass auch im Bereich der außermenschlichen Kreatur und des Körperlichen gravierende Veränderungen infolge des Sündenfalls eingetreten sind. Dabei beschränkt sich der Text auf Umbrüche, die den Menschen betreffen.
In V. 19 ist außerdem vom physischen Tod die Rede, vom Zurückkehren zum Staub. Die Formulierung „bis du zurückkehrst“ setzt voraus, dass die in 2,17 ausgesprochene Warnung „wirst du des Todes sterben“ bereits gültig geworden ist.
In 1. Mose 6,12 wird schließlich gesagt, dass „alles Fleisch seinen Weg auf Erden verdorben“ hatte. Somit ist das frühere Urteil des Schöpfers über seine Schöpfung („alles war sehr gut“; 1. Mose 1,31) ins Gegenteil verkehrt worden. Mit der Wendung „alles Fleisch“ ist die gesamte Menschen- und Tierwelt gemeint.
1.4 Zusammenfassung
Die Bibel schildert die heutige Schöpfung mit recht pessimistischen Worten: Die Schöpfung seufzt, ist von Schmerzen gezeichnet und durch Vergänglichkeit geknechtet. Es wird ein Unterschied zwischen dem heutigen und dem Ursprungszustand gemacht: Die „Knechtschaft der Vergänglichkeit“ begann demnach erst nach einer „Unterwerfung“. Der Tod gehört nicht zur ursprünglichen Schöpfung. Ebenso wird es zukünftig eine ganz andere neue Schöpfung ohne Tod durch Gottes Eingreifen geben. Der Einschnitt, durch den es zur Knechtschaft der Schöpfung kam, ist aufs Engste mit dem Sündenfall des Menschen verbunden.
Eine solche Sicht von einem einschneidenden Umbruch in der Geschichte der Schöpfung passt nicht zu einer evolutionären Weltanschauung. Denn danach gab es das Seufzen des Schöpfung schon immer und insbesondere vor dem Auftreten des Menschen und unabhängig von dessen Sünde.
1.5 Literatur
Junker R (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Neuhausen-Stuttgart.
Junker R (2001) Sündenfall und Biologie. Schönheit und Schrecken der Schöpfung. Neuhausen-Stuttgart.
Autor: Reinhard Junker, 17.05.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2042.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen (Experten)
2.0 Inhalt
In diesem Artikel werden einige biblische Texte ausgelegt, die den gegenwärtigen Zustand der Schöpfung thematisieren und Hinweise darauf geben, wie es zur heutigen „Knechtschaft“ (Römer 8,20) der Schöpfung gekommen ist.
2.1 Problemstellung
Im Artikel |0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung| wurde anhand zahlreicher Beispiele die auf Fressen und Gefressenwerden angelegte Ökologie der uns vertrauten Schöpfung demonstriert. Die Schöpfung in der uns geläufigen Erfahrung ist nicht nur durch Schönheit, Vielfalt und Zweckmäßigkeit gekennzeichnet, sondern auch durch Zerfall, Missbildung, Krankheit und Tod. In der Schöpfung sind Zerstörungs- und Todesmechanismen ständig wirksam – mehr noch: Die gegenwärtige Ökologie kann nur durch solche Vorgänge im Gleichgewicht gehalten werden. Die ökologischen Kreisläufe basieren auf gegenseitigem Verzehr der Organismen. Dazu verfügen die Lebewesen über Strukturen und Verhaltensweisen, die ihnen das Jagen, Fangen, Verzehren und Verwerten tierischer Nahrung ermöglichen.
In diesem Artikel soll aufgezeigt werden, was die Heilige Schrift zu dieser destruktiven Seite der Schöpfung sagt. Wir nennen dieses „Gesicht“ der Schöpfung „fallsgestaltig“, weil es (wie gezeigt wird) aus biblischer Sicht mit dem Sündenfall zu tun hat. Wir werden dazu zwei Aspekte kennenlernen: 1. Die Bibel zeichnet zwei sehr gegensätzliche „Gesichter“ der Schöpfung, neben dem schönen und angenehmen auch ein häßliches fallsgestaltiges. 2. Die Bibel erklärt, dass die destruktive Seite nicht von Anfang an zur Schöpfung gehörte, sondern erst nachträglich in sie eindrang. Dies soll im Folgenden anhand einiger biblischer Texte gezeigt werden. Im Artikel |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung| werden Denkhilfen gegeben, wie man sich einen Umbruch von einer Welt ohne Tod in die heutige vom Tod gekennzeichneten Welt vorstellen könnte.
2.2 Was sagt die Schrift zur heutigen Schöpfung?
Was sagt die Bibel zur uns vertrauten Ökologie, die auf Fressen und Gefressenwerden basiert? Im Neuen Testament findet sich dazu im 8. Kapitel des Römerbriefs (Verse 19-22) ein aufschlussreicher Text. Er soll zunächst in der Übersetzung nach Menge wiedergegeben werden:
(19) Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. (20) Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf Hoffnung hin, (21) dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. (22) Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt.
Der Text steht im Zusammenhang des Leidens der Jünger und ihrer Hoffnung auf die Herrlichkeit. In ihm wird auch der Zusammenhang zwischen dem Leiden der Nachfolger Jesu und dem Leiden der Schöpfung insgesamt angesprochen. Auch die Schöpfung wartet auf Erlösung. Ihr Jetztzustand entspricht nicht dem ursprünglichen: die Schöpfung wurde der Nichtigkeit bzw. Vergänglichkeit unterworfen; sie war also früher anders. Damit wird ein früherer herrlicher Zustand der Ursprungswelt vorausgesetzt. Wir legen den Text unter drei Fragestellungen aus. Zunächst geht es um die Beschreibung der heutigen Schöpfung, sozusagen um eine Diagnose ihres Zustandes. In der folgenden Wiederholung des Textes sind dazu einige Charakterisierungen fett hervorgehoben:
(19) Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. (20) Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf Hoffnung hin, (21) dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. (22) Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt.
Wer ist mit „Schöpfung“ gemeint? Mit „Schöpfung“ (griech. ktisis) ist die gesamte außermenschliche Schöpfung gemeint. Es wird nämlich ausdrücklich gesagt, dass die gesamte Schöpfung seufzt (V. 20 und 22), was nahelegt, dass mit ktisis auf jeden Fall mehr als nur die Menschheit gemeint ist. Wenn die Menschen gemeint wären, sollte man einen anderen Begriff erwarten. Weiter wird gesagt, dass die ktisis ohne ihren Willen unterworfen wurde, also nicht schuldhaft, was sonst in der Heiligen Schrift von den Menschen ja gerade nicht gesagt wird. Das passt nur zur außermenschlichen Schöpfung.
Im Artikel |0.2.1.3 Die Bindung der Erdgeschichte an den Sündenfall des Menschen| wird in anderem Zusammenhang ebenfalls auf diese Stelle eingegangen. Dort wird eine detaillierte Arbeit des Neutestamentlers H.-K. Chang (2000) erwähnt, in der gezeigt wird, dass ktisis in Röm 8,19-22 weder die gläubige noch die ungläubige Menschheit noch auch Engel oder Dämonen meinen kann. Vielmehr kommt nur die außermenschliche, vernunftlose Schöpfung in Frage.
Schließlich ist auch aufgrund des ökologischen Zusammenhangs von Mensch und außermenschlicher Schöpfung anzunehmen, dass die außermenschliche Schöpfung gemeint (bzw. mindestens eingeschlossen) ist. Denn es ist kaum glaubhaft, dass zwar der Mensch der Vergänglichkeit unterworfen wurde, nicht aber die Tierwelt, oder dass zwar schon immer die Tierwelt der Vergänglichkeit unterworfen war, der Mensch ursprünglich jedoch nicht. Das passt ökologisch nicht zusammen. Da der Mensch offensichtlich Zielpunkt der Schöpfung ist, auf den alles zugeordnet wird (vgl. besonders 1. Mose 2), erscheint auch aus biblischen Gründen die Vorstellung unhaltbar, die „Knechtschaft der Vergänglichkeit“ (V. 21) könnte nur den Menschen betroffen haben. Vielmehr betrifft das Verhalten des Menschen die gesamte Schöpfung, weil sie auf ihn bezogen ist (vgl. 1. Mose 3; s. u.).
Wie wird die Schöpfung beschrieben? Zum Verständnis dieser Passage ist die Bedeutung des Begriffs „Nichtigkeit“ bzw. „Vergänglichkeit“ in V. 20 wichtig. Der Begriff wird betont an den Anfang des Satzes gestellt. Er bezeichnet die Vergeblichkeit, die Inhaltsleere und die Nichtigkeit, vielleicht auch die Verkehrtheit und die Unordnung der Welt; die Schöpfung ist einem verderbenden Prozess ausgeliefert (so der Neutestamentler O. Michel). Auch an den Überlebenskampf kann hier gedacht werden. Weiter wird die Schöpfung als seufzend, geknechtet und mit Schmerzen gezeichnet beschrieben. Die „Knechtschaft der Vergänglichkeit“ wird in einen Gegensatz zur Herrlichkeit der Söhne Gottes gestellt. Dieser krasse Gegensatz macht deutlich, dass die gegenwärtige Welt wesensverschieden von der kommenden ist – wie sie auch wesensverschieden von der ursprünglichen Welt ist. Von der Schöpfung als Ganze wird also ein ausgeprägt pessimistisches Bild gezeichnet. Von daher ist schon klar, dass diese Existenzweise der Schöpfung nicht die ursprüngliche sein kann, wie sie aus Gottes Schöpferhänden kam. Gott hat am Anfang keine seufzende, geknechtete, der Vergänglichkeit unterworfene Schöpfung ins Dasein gebracht. Damit kommen wir von der Diagnose zur „Ursachenforschung“.
Wie kam es zur „Knechtschaft der Vergänglichkeit“? Auch zu dieser Frage gibt der Text aufschlussreiche Hinweise.
(19) Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. (20) Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat …
Der Text sagt, dass der gegenwärtige „Status“ durch eine „Unterwerfung“ in Kraft getreten ist. Der Unterwerfer kann nur Gott sein, denn nur er kann auf Hoffnung unterwerfen. Vor dem Hintergrund anderer biblischer Aussagen wird man freilich auch sagen müssen, dass der Widersacher Gottes, der Satan, seine Hand irgendwie im Spiel hatte, doch er hat nur den von Gott eingeräumten Spielraum. (Wir stehen hier vor der sog. Theodizee-Frage, der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leides in der Welt, vgl. dazu Artikel |0.5.2.4.1 Das Theodizee-Problem|.) Der Aspekt, dass auf Hoffnung hin unterworfen wurde, zeigt, dass Gott der eigentlich Handelnde ist. Außerdem wird der sog. passivus divinus (göttlicher Passiv) verwendet: „wurde unterworfen“ – ein in der ganzen Bibel übliches Stilmittel, um das Handeln Gottes auszudrücken, ohne seinen Namen ausdrücklich zu nennen.
Das Verhängnis des Unterworfenseins unter die Knechtschaft der Vergänglichkeit gilt nicht grundsätzlich, sondern es kennt einen Anfang und ein Ende. Das wird durch die Verwendung der (nur im Griechischen vorhandenen) Zeitform des Aorists ausgedrückt, der einen diesem Ereignis vorausgehenden Zustand voraussetzt, in welchem die Schöpfung nicht unter diesem Verhängnis stand.
Der oben erwähnte Neutestamentler Chang schreibt dazu: „Die ‚Knechtschaft’ unter die physische [körperliche| ‚Verderbnis/Vergänglichkeit’, in deren Zustand sich die außermenschliche Schöpfung gegenwärtig befindet (V. 21b), beruht auf dem historischen Ereignis, dass diese Schöpfung einstmals der physischen ‚Nichtigkeit unterworfen’ wurde (V. 20a)“ (Chang 2000, S. 134). Oder einfacher ausgedrückt: „Die ganze Erde/Schöpfung [ist| durch die Übertretung Adams und zusammen mit Adam der Nichtigkeit und dem Niedergang verfallen“ (S. 227).
Aus Römer 8,19ff. geht also hervor, dass die Schöpfung ursprünglich wesensmäßig anders beschaffen war als heute. Sie wurde der Vergänglichkeit unterworfen und besaß somit ursprünglich dieses Merkmal nicht. Folglich hatte sie andere Eigenschaften, die allerdings unserem Vorstellungsvermögen entzogen sind. Das gilt umgekehrt genauso für die verheißene zukünftige Schöpfung. Die Sehnsucht nach einer gemeinsamen Erlösung wird verstehbar vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Falles. So wie der Mensch auch „nicht aus der Welt erlöst wird, sondern mit ihr“ (Paul Althaus), wurde die gesamte Welt mit dem Menschen in die Bedingungen „dieses Äons“ hineingerissen.
Die Schöpfung wurde „ohne ihren Willen“ unterworfen, also nicht schuldhaft. Das weist auf den Menschen als Auslöser hin. Damit wird nahegelegt, dass das Unterworfensein Folge des Sündenfalls des Menschen ist und somit erst nachträglich die Schöpfung kennzeichnet. Nicht von ungefähr verstehen viele Ausleger diese Passage als neutestamentliche Auslegung der Sündenfallerzählung (1. Mose 3).
Martin Luther stellte fest: „Ihr werdet also dann die besten Philosophen und die besten Naturforscher sein, wenn ihr vom Apostel lernt, die Kreatur als eine harrende, seufzende, in Wehen liegende zu betrachten, d. h. als eine, die das, was ist, verabscheut, und nach dem verlangt, was zukünftig und darum noch nicht ist.“ Der Naturforscher deutet die Schöpfung richtig, wenn er die Kreatur nicht alleine aus innerweltlichen Entstehungsbedingungen heraus zu verstehen versucht, sondern sie als gefallene („unterworfene“) und auf Erlösung wartende Schöpfung begreift.
Eine nachträglich verhängte Vergänglichkeit und ein dadurch bedingtes Seufzen der Schöpfung und sehnsüchtiges Harren auf Befreiung von diesem Zustand passt übrigens ganz und gar nicht zur Evolutionslehre. Denn danach gäbe es dieses Seufzen schon von Anfang an, und in ihrer Sichtweise gibt es keinen Einschnitt, durch den die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde (vgl. dazu |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament|).
Die Zukunft der Schöpfung. Glücklicherweise bleibt der Text nicht bei der Diagnose und der Ursachenforschung stehen, sondern gibt auch eine Perspektive. Der gegenwärtige Zustand der Schöpfung ist zwar durchaus bedrückend, aber nicht trostlos. Es gibt eine Hoffnung auf eine Befreiung von der Knechtschaft:
(20) … jedoch auf Hoffnung hin, (21) dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. (22) Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt.
Es wird eine neue Schöpfung geben, in der es keine Vergänglichkeit und das mit ihr verbundene Seufzen und Geknechtetsein mehr geben wird. (Das bezeugt die Bibel auch an anderen Stellen.) Der Weg dahin wird als Befreiung und als Neugeburt beschrieben. Es ist klar, dass dies nur durch das Eingreifen Gottes geschehen wird.
2.3 Weitere Texte im Neuen und Alten Testament
In Römer 5,12-19 stellt Paulus einen bestimmten Menschen – Adam – Jesus Christus gegenüber. Beide entsprechen einander in gewissem Sinne: Adam ist der Stammvater der Menschheit wie Jesus der „Anfänger einer neuen Menschheit“ (Paul Althaus) ist:
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist, und durch die Sünde der Tod …
Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung. (Röm. 5,12+18)
In unserem Zusammenhang ist hier bedeutsam, dass die Sünde des Adam den Tod aller Menschen nach sich zog. Dass durch die Tat eines einzigen der Tod in die Welt kam, wird durch die Gegenüberstellung zu dem einen, Jesus Christus, hervorgehoben. Wie Jesus eine bestimmte Person ist, die als Jesus aus Nazareth auf dieser Erde gelebt hat, so war es auch Adam. Somit bezeugt Paulus mit diesen Sätzen in Römer 5, dass eine historische Person das Einfallstor des Todes in diese Welt war. Nach diesem Zeugnis kann also der Tod nicht als ursprünglich angesehen werden. Somit wird abermals deutlich, dass die Bibel Sünde und Tod als Kennzeichen „dieses Äons“ (d. h. der Zeit nach dem Sündenfall und vor Jesu Wiederkunft) charakterisiert, nicht jedoch als zur „guten Schöpfung“ wesensmäßig gehörig. So wie Christi Sterben eine Bedeutung für den ganzen Kosmos hat, so auch die Sünde des ersten Adam. (Mehr dazu im Artikel |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament|.)
Zudem wird der Tod als der „letzte Feind“ Gottes bezeichnet (1. Kor. 15,26), der besiegt werden wird. Dies macht ebenfalls deutlich, dass der Tod nicht zur ursprünglichen Schöpfung gehört.
Das Wirken Satans. Die Tatsache, dass dem „Fürsten dieser Welt“ eine begrenzte und kontrollierte, destruktive Tätigkeit eingeräumt wird (vgl. Hiob 1; Mt 4,1-11; 1. Joh 3,8) muss ebenfalls als Zeugnis dafür gewertet werden, dass die Welt gefallene Schöpfung und nicht das Ergebnis ausschließlich natürlicher Prozesse und nicht so aus Gottes Schöpferhand gekommen ist. In der Versuchungsgeschichte (Mt 4,1-11 par) widerspricht Jesus dem Satan nicht, als dieser ihm alle Reiche der Welt zur Herrschaft anbietet. Das bedeutet nichts weniger, als dass Satan einen erstaunlichen Wirkungsraum hat. Da von „allen Reichen dieser Welt“ die Rede ist, beschränkt sich diese Wirkung nicht auf einen existentiellen Bereich, auch nicht auf den Menschen.
Jesu Taten. Die Krankenheilungen und Totenauferweckungen Jesu verdeutlichen ebenfalls, dass Krankheit, Leid und Tod Eindringlinge sind, die nicht zur guten Schöpfung Gottes gehören, sondern als Gerichtszeichen zu werten sind. Jesus drängt Krankheit und Tod durch seine Machtworte zurück.
Texte aus der Genesis. Im Neuen Testament werden die ersten elf Kapitel der Genesis (1. Buch Mose) als Schilderungen tatsächlicher Begebenheiten verstanden und aufgegriffen. Das ergibt sich aus dem Umgang Jesu Christi und der Schreiber des Neuen Testamentes mit diesen Texten. (Nähere Erläuterungen dazu in |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament|.) Die Genesistexte werden daher nicht als zeitlose Wahrheiten angesehen, die in „Geschichten“ eingekleidet wurden, sondern als Zeugnisse tatsächlich abgelaufener Geschichte.
Für unsere Fragestellung von besonderer Relevanz sind somit vor allem folgende Teststellen aus 1. Mose 1 bis 11:
- Neben dem Zeugnis, dass die Lebewesen in gegliederten Einheiten („Arten“) geschaffen wurden, sind zunächst die Verse 1. Mose 1,29 und 30 wichtig, denn sie geben Auskunft über die Art der Nahrung. Sowohl den Tieren als auch den Menschen wird pflanzliche Nahrung zugewiesen:
Dann fuhr Gott fort: „Hiermit übergebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit samentragenden Früchten: die sollen euch zur Nahrung dienen! Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, was Lebensodem in sich hat, weise ich alles grüne Kraut der Pflanzen zur Nahrung an.“ Und es geschah so. (1. Mose 1,29.30)
Tiere sollten also nicht durch Räuber oder Parasiten sterben. Wären sie überhaupt gestorben, wenn es nicht zum Sündenfall gekommen wäre? Dazu wird im Text nichts ausdrücklich gesagt. Dennoch wird man im Anschluss an Röm 5 und 8,19ff. (s. o.) annehmen müssen, dass auch das Sterben der Tiere Ausdruck des „Unterworfenseins“ und des Seufzens der gesamten Schöpfung ist, vgl. die obigen Darlegungen.
- Ebenfalls von Bedeutung für unser Thema ist der Vers 1. Mose 1,31: „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Die Feststellung, dass alles sehr gut war, schließt die Deutung aus, dass nur bestimmte Aspekte der Schöpfung sehr gut waren, etwa in dem Sinne, dass nur die Zweckmäßigkeit der organismischen Strukturen damit gemeint sei.
- Bedeutend ist dann 1. Mose 3,16-19, die Fluchworte Gottes als Reaktion auf den Ungehorsam und Unglauben von Adam und Eva. Hier werden einige Hinweise dafür gegeben, dass mit dem Sündenfall Umbrüche und einschneidende Veränderungen auch im physikalisch-chemischen und biologischen Bereich einhergingen.
So wird in V. 16 die Mühsal der Frau in der Schwangerschaft und bei der Geburt genannt. Aus dem Fluchwort geht hervor, dass Schwangerschaft und Geburt ursprünglich etwas ausschließlich Schönes sein sollten. Jetzt dagegen wird die Freude am neuen Leben getrübt, ja sogar mit Todesgefahr für Mutter und Kind überschattet. Es bereitet dem Anatomen keine Mühe, die Geburtsschmerzen und diese Gefahren physiologisch bzw. anatomisch zu erklären; sie resultieren z. B. aus der Enge des Geburtskanals. Unser Text hebt nun gerade hervor, dass die Schmerzen des Gebärens keine „Naturnotwendigkeit“ sind.
Auch der Mann ist durch den Fluch betroffen (V. 17-19; 5,29), denn von nun an geschieht Arbeit gegen Widerstand. Der Acker wird verflucht, und das hat zur Folge, dass Dornen und Disteln die Arbeit behindern. Der Ertrag der Arbeit steht oft in keinem Verhältnis zu ihrem Aufwand. Das ist nicht aus Gottes ursprünglicher Ordnung zu erklären. Hier wurde die Außenwelt verändert. Es werde deutlich, dass die Konsequenzen des Falls nicht auf die Innenwelt des Menschen beschränkt werden können.
Diese knappen Hinweise aus diesem 3. Kapitel des Genesisbuches sind insofern bedeutungsvoll, als sie eine Ahnung davon geben, dass auch im Bereich der außermenschlichen Kreatur und des Körperlichen gravierende Veränderungen infolge des Sündenfalls eingetreten sind. Dabei beschränkt sich der Text auf Umbrüche, die den Menschen betreffen. Der Naturforscher würde gerne mehr erfahren, aber die Bibel schweigt sich aus. Doch auch wenn dieser Text nicht für den Biologen geschrieben wurde, so ist er doch für ihn von Bedeutung. Zusammen mit Röm 8,19ff. gibt er entscheidende Hinweise für die Deutung des Widerspenstigen, Widerwärtigen und Destruktiven („Fallsgestaltigen“, s. o.) in der Schöpfung.
Wichtig ist auch die Wendung „um deinetwillen“ (V. 17). Sie macht abermals deutlich, dass die Konstitution des Ackers nicht einfach Ausdruck naturgesetzlich wirkender Kräfte ist, sondern eine Folge der Sünde des Menschen: Der Schöpfer hat neue, die Lebensmöglichkeiten einschränkende Lebensbedingungen gesetzt bzw. zugelassen.
In V. 19 ist außerdem vom physischen Tod die Rede, vom Zurückkehren zum Staub. Die Formulierung „bis du zurückkehrst“ setzt voraus, dass die in 2,17 ausgesprochene Warnung „wirst du des Todes sterben“ bereits gültig geworden ist.
- 1. Mose 6,12 („alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden“) ist insofern bedeutsam, als das frühere Urteil des Schöpfers über seine Schöpfung („alles war sehr gut“; 1. Mose 1,31) sich ins Gegenteil verkehrt hat. Mit der Wendung „alles Fleisch“ ist die gesamte Menschen- und Tierwelt gemeint. Dass nicht nur die Menschen gemeint sind, geht aus den Versen 13 und 21 hervor, wo diese Wendung ebenfalls gebraucht wird und wo aufgrund des Kontextes kein Zweifel besteht, dass die Tiere eingeschlossen sind, besonders deutlich in V. 21: „Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen.“
2.4 Schöpfung am Anfang und neue Schöpfung
Nicht nur der Blick in die Vergangenheit, auch die biblische Zukunftshoffnung lässt Licht auf unsere Fragestellung fallen. Die Bibel bezeugt auch eine künftige Veränderung der Lebensbedingungen und damit notwendigerweise des Baues und Verhaltens der Lebewesen, wenn Gott Himmel und Erde neu schafft (2. Petr. 3,13; Offb. 21). Was dabei geschieht, entzieht sich unserer Vorstellungswelt in gleichem Maße wie die Welt vor dem Sündenfall.
Besonders in Offb. 21,4.5 wird eine Parallelität zwischen Ursprungswelt und der neuen Schöpfung gezeigt: „…der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ Diese Merkmale sind unter den heutigen ökologischen und physikalischen Rahmenbedingungen nicht möglich. Die zukünftige Welt, die Gott schaffen wird, ist wesensmäßig ebenso von der heutigen verschieden wie die ursprüngliche Welt vor dem Fall. Der Übergang zur neuen Welt erfolgt nicht evolutionär, sondern durch Gottes Eingreifen.
Diese biblischen Verheißungen eines Neuwerdens der Schöpfung durch Gottes Handeln lassen auch ein Gerichtshandeln Gottes „nachvollziehbar“ erscheinen, das die physikalischen Rahmenbedingungen und die biologischen Gestalten verändert hat (dies wird im Artikel |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung| erläutert). Die angesprochene Parallelität zeigt sich auch insofern, als beide Einschnitte Erkenntnisschranken darstellen, über die nicht extrapoliert werden kann.
Die Parallelität zwischen der neuen Schöpfung und der Urgeschichte wird auch im Alten Testament angesprochen. In Offb. 21 werden Verheißungen aus Jes 11,6-10; 25,8; 65,17.25 und 66,22 aufgegriffen (vgl. auch Hos 2,20). In Jes 65,17ff. geht es allerdings nicht um die Neuschöpfung nach Offb. 21, sondern um das in Offb. 20,1-6 beschriebene tausend Jahre der Bindung Satans („tausendjähriges Reich“). Dort ist nur eine Verklärung der bestehenden Welt gemeint. Das Neue betrifft nur Zustände auf der alten Erde, nicht aber diese selbst wie in Offb 21 oder 2. Petr 3. Doch weist auch Jesaja auf eine Zeit hin, in der es auch keinen Tod mehr geben wird (25,8). Beachtlich sind die Parallelen in den Beziehungen zwischen den Tieren. Raubtiere werden sich nicht mehr wie Raubtiere verhalten (11,6ff.; 65,25). Außerdem gibt es keine fruchtlose, sinnlose Arbeit mehr.
2.5 Zusammenfassung
Die Bibel schildert die heutige Schöpfung mit recht pessimistischen Worten: Die Schöpfung seufzt, ist von Schmerzen gezeichnet und durch Vergänglichkeit geknechtet. Es wird ein Unterschied zwischen dem heutigen und dem Ursprungszustand gemacht: Die „Knechtschaft der Vergänglichkeit“ begann demnach erst nach einer „Unterwerfung“. Der Tod gehört nicht zur ursprünglichen Schöpfung. Ebenso wird es zukünftig eine ganz andere neue Schöpfung ohne Tod durch Gottes Eingreifen geben. Der Einschnitt, durch den es zur Knechtschaft der Schöpfung kam, ist aufs Engste mit dem Sündenfall des Menschen verbunden.
Eine solche Sicht von einem einschneidenden Umbruch in der Geschichte der Schöpfung passt nicht zu einer evolutionären Weltanschauung. Denn danach gab es das Seufzen der Schöpfung schon immer und insbesondere vor dem Auftreten des Menschen und unabhängig von dessen Sünde.
2.6 Literatur
Chang H-K (2000) Die Knechtschaft und Befreiung der Schöpfung. Eine exegetische Untersuchung zu Römer 8,19-22. Wuppertal.
Junker R (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Neuhausen-Stuttgart.
Junker R (2001) Sündenfall und Biologie. Schönheit und Schrecken der Schöpfung. Neuhausen-Stuttgart.
Autor: Reinhard Junker, 17.05.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/e2042.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung (Interessierte)
Der Übergang von einer Ursprungsökologie ohne Tod in der Schöpfung in die heutige Ökologie kann in vielen Fällen nur umbruchsartig erfolgt sein. Dieser Vorgang ist unzugänglich und daher unerforschbar. Die heutige Biologie liefert aber Modelle dafür, wie man sich einen solchen Umbruch vorstellen kann, ohne dass eine Neuschöpfung erforderlich ist und ohne dass destruktive Strukturen in der ursprünglichen Schöpfung bereits verwirklicht gewesen sein mussten.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird ein Modell vorgestellt, wie ein abrupter Übergang von einer ursprünglichen Schöpfung ohne destruktive („fallsgestaltige“) Räuber-Beute-Beziehungen und ohne Tod in die heutige Ökologie des Fressens und Gefressenwerdens denkbar sein könnte.
1.1 Problemstellung
Im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| wurde die biblische Sicht von den destruktiven Seiten der Schöpfung dargelegt. Die Bibel charakterisiert diese Seite der Schöpfung als Ausdruck eines kräftigen Missklangs, nicht als Selbstverständlichkeit. Dieser Missklang gehört aber nicht zur ursprünglichen, „sehr guten“ Schöpfung, sondern ist erst nachträglich in die Schöpfung eingedrungen. Da der Sündenfall des Menschen das Einfallstor für den Tod in der Schöpfung war, kann man die Strukturen in der Schöpfung, die mit dem Fressen und Gefressenwerden von Tieren zu tun haben, auch als „fallsgestaltig“ bezeichnen, um den Ausdruck „destruktiv“ zu vermeiden, der zu kurz greift. Mit „fallsgestaltig“ sind also Lebensstrukturen gemeint, die zum Erbeuten und Verzehr von Tieren benötigt werden, ferner Einrichtungen für Parasitismus, aber auch Mechanismen der Feindabwehr. Fallsgestaltige Strukturen werden detailliert im Artikel |0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung| beschrieben.
Vor dem biblischen Hintergrund stellt sich die Frage, wie man sich einen Umbruch von der ursprünglichen in die jetztzeitliche Schöpfung biologisch denken kann, wenn man nicht annehmen will, dass in der „sehr guten“ Schöpfung bereits die fallsgestaltigen Kennzeichen angelegt waren. Wie kamen die fallsgestaltigen Strukturen in die Schöpfung? Da 1. Mose 1-11 ein historisches Geschehen schildert (vgl. |0.2.1.3 Die Bindung der Erdgeschichte an den Sündenfall des Menschen|), hat es einen Umbruch von einer ursprünglich „sehr guten“ (1. Mose 1,31) zu einer „völlig verderbten“ (1. Mose 6,12) Schöpfung gegeben. Was hat zu diesem Umbruch geführt? Welche Veränderungen haben ihn herbeigeführt? Was ist im Einzelnen dabei geschehen? Sind solche Fragen überhaupt beantwortbar?
Diese Fragen stellen sich im Rahmen der Evolutionslehre nicht. Während einer allgemeinen Evolution der Lebewesen kann es keinen Umbruch zwischen den Lebensbedingungen vor und nach einem Sündenfall gegeben haben. Doch die evolutionäre Weltsicht steht im Widerspruch zur biblischen Sicht von der Schöpfung (vgl. |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament|). Daher wird hier eine andere Lösung verfolgt.
1.2 Was muss sich bei einem Umbruch in der Schöpfung geändert haben?
Wird 1. Mose 1-11 also historisch-faktisch verstanden, erhebt sich die Frage, wie ein Umbruch von der Ursprungsökologie (ohne Tod) in die heutige Ökologie (mit Tod) vonstatten gegangen sein könnte. Es soll ausgeschlossen werden, dass Gott Fallsgestaltiges am Anfang geschaffen und damit von vornherein gewollt hat, denn dies bedeutete, dass es zur Schöpfung wesensmäßig gehörte. Das heißt: Alle Strukturen und Verhaltensweisen, die ausschließlich zum Finden, Erbeuten, Verzehren und Verdauen lebendiger tierischer Nahrung benötigt werden, haben in der ursprünglichen Schöpfung keinen Platz (fallsgestaltige Strukturen). Im Artikel |0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung| wird einiges dazu beschrieben.
Da die Unterschiede zwischen einer Ursprungs- und der Rezent-Ökologie tiefgreifend sein müssen, erscheint es unmöglich, den Aufbau und die Gesetze der Biosphäre vor dem Sündenfall anschaulich zu beschreiben. Wir können uns keine Begriffe von einem Ökosystem machen, in dem die in 1. Mose 1,30 angedeuteten Zustände herrschen (keine Tiernahrung). Die ursprüngliche Schöpfung vor dem Fall ist und bleibt ein echtes Geheimnis. Daher ist es auch nicht möglich, einen Übergang von der ursprünglichen zur heutigen Ökologie auszumalen. Der nachfolgende spekulative Deutungsversuch soll daher nur als Denkhilfe verstanden werden, nicht jedoch als Versuch, etwas gedanklich in den Griff zu bekommen, was jenseits des Begreifens und der Begriffsmöglichkeiten des Menschen liegt.
1.3 Entwicklung zur fallsgestaltigen Lebensweise?
Ein aus biologischen Gründen nur in manchen Fällen vertretbarer Deutungsversuch ist die Annahme einer allmählichen Entstehung der Raubtiergestalt bzw. der räuberischen Lebensweise durch mikroevolutive, empirisch bekannte Prozesse nach dem Sündenfall. (Zum Begriff „Mikroevolution“ siehe Artikel |1.3.1.3 Mikro- und Makroevolution|.) In vielen Fällen reicht dies aber nicht aus, nämlich dann, wenn die Entstehung fallsgestaltiger Strukturen Makroevolution erfordert.
Die Vorstellungen eines allmählichen Umbruchs scheitert außerdem an der Tatsache, dass alle Lebewesen ökologisch durch Fressen und Gefressenwerden miteinander verbunden sind. Ein allmählicher Übergang von einem ganz anders organisierten Ökosystem in heutige komplizierte Bedingungen entzieht sich ebenfalls einer Erklärung durch bekannte biologische Prozesse.
1.4 Sprunghafte Veränderungen?
Der nachfolgende Deutungsversuch nimmt auf die Erkenntnis der Biologie Bezug, dass die Lebensprozesse hierarchisch organisierten Steuerungen unterliegen. Schon im Erbgut muss zwischen Strukturgenen und Regulatorgenen unterschieden werden. Die Strukturgene stehen für Eiweiße (Bau- oder Stoffwechselproteine), die Regulatorgene für solche Proteine, die beim kontrollierten Ablesen der Strukturgene benötigt werden. Doch die Regulatorgene steuern selber nicht. Sie sind lediglich eine notwendige Voraussetzung dafür, dass die Information auf den Strukturgenen kontrolliert abgelesen und für den Zellstoffwechsel nutzbar gemacht werden kann. Die Regulatorgene bedürfen ihrerseits der Regulation. Dies geschieht z. B. durch Hormone, das sind Botenstoffe, die über die Blutbahn zirkulieren. Diese aber wiederum müssen selber von einer noch höheren Instanz reguliert werden und so weiter. Man kann also festzuhalten, dass man nach bisherigen Forschungsergebnissen davon ausgehen muss, dass das Erbgut und die vorgeschalteten Steuerungen hierarchisch strukturiert sind. (Das ist stark vereinfacht dargestellt; die tatsächliche Situation ist durch Rückkopplungen und vernetzte Beziehungen viel komplizierter, doch tut das für die hier verfolgte Fragestellung nichts zur Sache.) Was aber ist die höchste Instanz? Kann sie überhaupt materiell in den Lebewesen gefasst werden? Es stellte sich dann sofort die Frage, was diese Instanz wiederum in Aktion versetzt.
Anwendung: Wie entstanden die fallsgestaltigen Strukturen? Man könnte sich in der anstehenden Frage nach dem Übergang in die Bedingungen und Strukturen nach dem Fall folgendes denken: Die genetischen Grundlagen (die Bausteine als solche) wurden im Gefolge des Sündenfalls nicht geändert, die Instanz aber, die ihren Zusammenbau regelt, reagiert auf die veränderten Lebensbedingungen nach dem Fall. Mit demselben „Baumaterial“, also auf derselben genetischen Grundlage, werden verschiedenartige „Gebilde“ errichtet. Die höchste Instanz also, die die individuelle Entwicklung, den Bau und die Funktionsweisen der Lebensäußerungen regelt, könnte eine Wandlung erfahren haben, so dass unter den neuen Bedingungen nach dem Sündenfall bei vielen Lebewesen neue – fallsgestaltige – Strukturen zum Vorschein kommen.
Dies ist damit vergleichbar, dass man aus demselben Baumaterial ein Rathaus, eine Kirche oder ein Gefängnis bauen kann.
Modell aus der heutigen Biologie. Für diese Vorstellung gibt es ein interessantes Modell aus der heutigen, uns bekannten Biologie: die fremddienliche Zweckmäßigkeit, wie sie in bestechendster Form bei Pflanzengallen zu beobachten ist. Gallen sind spezifisch geformte Gebilde, die vor allem auf Blattoberflächen durch Einwirkung fremder Stoffe (von Bakterien, Pilzen oder Tieren) entstehen. So bildet beispielsweise die Rose nach einem Stich und der Eiablage der Rosengallwespe sog. „Rösenäpfel“ (Abb. 134), büschelige Gebilde, in deren Innern sich einige Kammern für die darin sich entwickelnden Larven befinden (Abb. 135). Es gibt eine reiche Formenvielfalt unter den Gallen. Manche gleichen spitze Hörnern, andere länglichen Zwiebeln, kugelrunden Murmeln, flachen Sonnenhüten, goldglänzenden Münzen oder Knöpfen (Abb. 136). Wichtig ist: Es werden Formen gebildet, die die Wirtspflanze sonst nicht erzeugt. Am gleichen Blatt können sogar verschiedene „Galltiere“ Gallen völlig unterschiedlicher Gestalt hervorrufen. Die neuen Entwicklungswege werden oft mit äußerster Präzision beschritten. Der Stoffwechsel wird zugunsten der Produktion bestimmter Inhaltsstoffe (z. B. Gerbstoffe) umgestellt, manche Wege werden intensiviert, andere verschlossen oder Seitenwege eingeschaltet.

Abb. 134: Ein Rosenapfel (Galle), der von der 3 mm langen Gemeinen Rosengallwespe hervorgerufen wird.

Abb. 135: Der Blick in das Innere eines Rosenapfels offenbart ein Röhrensystem, in dem Larven leben.

Abb. 136: Seidenknopfgallen an der Unterseite eines Eichenblattes, hervorgerufen durch eine Gallwespe
Als Auslöser für die Gallbildung dient den verschiedenen Schmarotzerarten ein Wuchsstoff. Erbsubstanz (DNS) wird jedoch nicht übertragen. I. a. sind die Gallen in komplizierter Weise den Bedürfnissen des Gastes angepasst. Dazu gehören ein passender Hohlraum, ein widerstandsfähiges Gehäuse, zartwandige, der Ernährung dienende Zellen im Innern der Gallen, die Erzeugung bitterer Stoffe, die Vögel oder Raupen vom Fressen abhalten, sowie z. T. die Ausbildung einer Trennschicht, die das Öffnen der Galle ermöglicht, sobald die Insassen zum Ausschwärmen alt genug sind (vgl. Abb. 137).

Abb. 137: Ein fertiges Gallinsekt in einer aufgeschnittenen Eichengalle.
Was geschieht hier? Unter dem Einfluss auslösender Substanzen wird das Baumaterial der Wirtspflanze zum Bau artfremder Strukturen verwendet. Die Gallen ähneln in ihrer Form gewöhnlich irgendwelchen normalen Pflanzenstrukturen nicht im entferntesten. Aber die genetische Grundlage der Pflanzen ist nicht verändert worden. Es werden keine Gene in die Pflanzen injiziert, es erfolgt keine Gentransplantation. Die Gene und der Zellstoffwechsel geraten offenbar unter „fremde Herrschaft“ und werden entsprechend genutzt.
Diesen Beispielen entsprechend könnte man sich denken, dass die geschaffenen Organismen durch den Sündenfall unter eine neue „Herrschaft“, unter eine Art Anpassungstrieb an die Bedingungen „dieses Äons“ gerieten und dadurch ihre Lebensweise änderten. Dieser „Herrschaftswechsel“ muss synchron und bei den verschiedenen Arten aufeinander abgestimmt erfolgt sein, so dass ein nahtloser Übergang in die Ökologie nach dem Sündenfall möglich war. Wichtig ist bei diesem Lösungsversuch, dass die Identität der Arten und Individuen gewahrt bleibt. Zugleich wird so verstehbar, dass das neue komplizierte ökologische Gefüge in seiner Fallsgestaltigkeit koordiniert „zusammengesetzt“ wurde.
Zur Verdeutlichung: Um die Lebensäußerungen der Organismen verstehen zu können, ist das Postulat [= Forderung] einer steuernden Größe sinnvoll. Man könnte es die „Steuerinstanz“ oder „steuerndes Agens“ eines Organismus nennen. Es ist nicht möglich, auf den untergeordneten Ebenen die Organismen zu verstehen. Die „steuernde Instanz“ (die gestaltende Kraft) kann zwar nicht vorgezeigt, jedoch nur an ihren Wirkungen erkannt werden.
Zur Vermeidung eines möglichen Missverständnisses soll noch erwähnt werden, dass Gallenbildung selber nicht als fallsgestaltiges Phänomen zu werten ist, sondern eine Symbiose [= Zusammenleben ohne einseitige Schädigung] darstellt. Das Beispiel soll nur als Illustration dienen, wie sich unter dem Einfluss einer fremden „Größe“ die Gestalt wandeln kann.
Im Rahmen dieses Lösungsversuchs muss nicht angenommen werden, Gott habe (unmittelbar oder latent) fallsgestaltige Anlagen erschaffen.
1.5 Physikalische Rahmenbedingungen
Ein ursprünglich wesensmäßig anderes Ökosystem bedurfte auch anderer physikalischer Rahmenbedingungen als der heutigen. Ohne Tod konnte es auch keine Todesgefahren gegeben haben. Was war z. B. anders, als das Gebären noch nicht schmerzvoll war? Man könnte sich denken, dass die Eigenschaften der Materie von den heutigen Eigenschaften verschieden waren, sodass die anatomischen Merkmale sich nicht schmerzhaft und gefahrvoll auswirkten. Denkbar wäre auch, dass die körperliche Konstitution anders war, so dass die Schmerzen und Gefahren ausgeschlossen waren.
Der Auferstehungsleib Jesu. Eine Gedankenhilfe dafür, dass eine andere Leiblichkeit als die uns bekannte möglich ist, bieten die neutestamentlichen Berichte von der Auferstehung Jesu. Einerseits wird in diesen Schilderungen großen Wert darauf gelegt, dass Jesus leiblich auferstand (er konnte angefasst werden, er aß etwas), andererseits wird bezeugt, dass Jesus durch geschlossene Türen gehen konnte. Wenn wir das versuchen würden, gäbe es mindestens blaue Flecken. Jesu Auferstehungsleiblichkeit war offenbar eine andere, wie auch der Auferstehungsleib der Gläubigen von anderer Qualität sein wird (vgl. 1. Kor 15,42+43). So kann man sich denken, dass die Leiblichkeit des Menschen, die noch nicht durch die Sünde betroffen war, von der heutigen Beschaffenheit verschieden war. Dabei kann jedoch nichts Sicheres darüber gesagt werden, inwiefern die ursprüngliche Leiblichkeit vor dem Sündenfall der künftigen Auferstehungsleiblichkeit gleicht.
1.6 Die zwei Gesichter der Schöpfung – Widerspiegelung des Menschen
Weshalb ist die ganze Schöpfung in den Fall des Menschen mit hineingerissen worden? Eine letztgültige Antwort auf diese Frage soll nicht gegeben werden und ist wohl auch nicht möglich. Römer 8,19ff. hebt diesen Zusammenhang nur hervor, ohne ihn näher zu begründen. Im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| wurde bereits auf die schöpfungsgemäße Sonderstellung des Menschen hingewiesen. Wenn das wichtigste Schöpfungswerk „verdorben“ ist, ist alles verdorben, was mit ihm verbunden ist – eben die ganze Schöpfung.
Aus der Verbundenheit zwischen der außermenschlichen Schöpfung und dem Menschen folgt: Die Schöpfung ist eine Widerspiegelung des Menschen und seiner Situation. Die Schöpfung kann sich nicht selber aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreien, sondern wartet auf den Befreier. Genauso ist es um den Menschen bestellt. Er ist nicht aufgrund eigener Möglichkeiten in der Lage, die Lebensverhältnisse grundlegend zu wandeln, auch er ist von der Vergänglichkeit geknechtet. Alle durchaus notwendigen und richtigen Bemühungen um Verbesserungen der menschlichen Existenz stehen letztlich unter dieser Feststellung. Sie soll nicht zur Resignation führen, sondern zu einem Realismus. Denn in Römer 8,19-22 wird nicht nur eine ernüchternde Diagnose gegeben, sondern auf eine Therapiemöglichkeit hingewiesen. Gott selber, der Unterwerfer, wird auch befreien. Es kann also nur darum gehen, sich dem Schöpfer und seiner Führung anzuvertrauen. Darauf soll uns das „verkehrte“ Gesicht der Schöpfung hinweisen: dass wir ohne Gott auf dem verkehrten Weg sind und seine Befreiung benötigen. Warum seufzt die ganze Schöpfung? „Nicht freiwillig“, sondern „um des willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat“. Damit sind wir gemeint.
Der Zugang zum Schöpfer ist offen, weil Jesus Christus durch sein Sterben und seine Auferstehung diesen Weg eröffnet hat. Jesu Auferstehung bedeutet die Überwindung des Todes und damit der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Die Auferstehung ist denen verheißen, die ihm nachfolgen.
1.7 Zusammenfassung
Nach dem Zeugnis der Bibel ist die Welt gefallene Schöpfung und die Daseinsweise der Lebewesen nicht einfach das Ergebnis natürlicher Prozesse. Es wird ein wesensmäßiger Unterschied zwischen der Ursprungswelt bzw. der zukünftigen Schöpfung und der Jetztgestalt der Schöpfung bezeugt. Ökologische Stabilität ist unter den Bedingungen der Jetztzeit („dieses Äons“) nur mit dem Beiklang des Seufzens (Rom 8,19ff.) möglich. Die Frage nach dem Übergang von einer ursprünglichen in die heutige Ökologie ist auf der biologischen Ebene nicht zu beantworten, da es keine entsprechende Erfahrungen aus dem heutigen, uns zugänglichen Bereich gibt. Ein allmählicher Übergang von der ursprünglichen in die heutige Lebensweise der Organismen kommt in der Regel nicht in Frage; es ist meist nur ein abrupter Umbruch denkbar, der die Bedingungen des jetzigen Daseins umfassend ändert. Aus der heutigen Biologie können vage Modelle für diesen Umbruch entnommen werden. Nach einer theologisch befriedigenden Modellvorstellung gerieten die Lebewesen im Gefolge des Sündenfalls unter „Steuerungsinstanzen“, die dem Ursprungsdasein „fremd“, dem jetzigen Dasein ausdrucksgemäß sind. Durch diesen Deutungsansatz sind tiefgreifende Organisationsänderungen und Änderungen der Lebewesen verstehbar, ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Schöpfung und ohne die Annahme, dass den Lebewesen schon ursprünglich, in der „sehr guten“ Schöpfung bereits genetische Grundlagen für eine andere Lebensweise „eingebaut“ waren.
1.8 Literatur
Junker R (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Neuhausen-Stuttgart.
Junker R (2001) Sündenfall und Biologie. Schönheit und Schrecken der Schöpfung. Neuhausen-Stuttgart.
Autor: Reinhard Junker, 16.04.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2043.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung (Experten)
2.0 Inhalt
In diesem Artikel wird ein Modell vorgestellt, wie ein abrupter Übergang von einer ursprünglichen Schöpfung ohne destruktive („fallsgestaltige“) Räuber-Beute-Beziehungen und ohne Tod in die heutige Ökologie des Fressens und Gefressenwerdens denkbar sein könnte.
2.1 Problemstellung
Im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| wurde die biblische Sicht von den destruktiven Seiten der Schöpfung dargelegt. Die Bibel charakterisiert diese Seite der Schöpfung als Ausdruck eines kräftigen Missklangs, nicht als Selbstverständlichkeit. Dieser Missklang gehört aber nicht zur ursprünglichen, „sehr guten“ Schöpfung, sondern ist erst nachträglich in die Schöpfung eingedrungen. Da der Sündenfall des Menschen das Einfallstor für den Tod in der Schöpfung war, kann man die Strukturen in der Schöpfung, die mit dem Fressen und Gefressenwerden von Tieren zu tun haben, auch als „fallsgestaltig“ bezeichnen, um den Ausdruck „destruktiv“ zu vermeiden, der zu kurz greift. Mit „fallsgestaltig“ sind also Lebensstrukturen gemeint, die zum Erbeuten und Verzehr von Tieren benötigt werden, ferner Einrichtungen für Parasitismus, aber auch Mechanismen der Feindabwehr. Fallsgestaltige Strukturen werden detailliert im Artikel |0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung| beschrieben.
Vor dem biblischen Hintergrund stellt sich die Frage, wie man sich einen Umbruch von der ursprünglichen in die jetztzeitliche Schöpfung biologisch denken kann, wenn man nicht annehmen will, dass in der „sehr guten“ Schöpfung bereits die fallsgestaltigen Kennzeichen angelegt waren. Wie kamen die fallsgestaltigen Strukturen in die Schöpfung? Da 1. Mose 1-11 ein historisches Geschehen schildert (vgl. |0.2.1.3 Die Bindung der Erdgeschichte an den Sündenfall des Menschen|), hat es einen Umbruch von einer ursprünglich „sehr guten“ (1. Mose 1,31) zu einer „völlig verderbten“ (1. Mose 6,12) Schöpfung gegeben. Was hat zu diesem Umbruch geführt? Welche Veränderungen haben ihn herbeigeführt? Was ist im Einzelnen dabei geschehen? Sind solche Fragen überhaupt beantwortbar?
Diese Fragen stellen sich im Rahmen der Evolutionslehre nicht. Während einer allgemeinen Evolution der Lebewesen kann es keinen Umbruch zwischen den Lebensbedingungen vor und nach einem Sündenfall gegeben haben. Eine allgemeine Evolution (vom Urknall zum Menschen) kennt, was Destruktivität, Krankheit, Missbildung, Leiden und Tod in der belebten Welt betrifft, keine prinzipiellen Umbrüche, seit es vielzelliges Leben gibt. Nur Einzeller sind potentiell unsterblich.
Die Evolutionslehre bietet durchaus eine Antwort auf Leiden und Tod in der Natur: beides sind notwendige Voraussetzungen für die Entfaltung der Lebensvielfalt und letztlich dafür, dass der Mensch entstehen konnte. Doch diese Antwort steht im Widerspruch zur biblischen Sicht von der Schöpfung (vgl. |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament| und |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|. Daher wird hier eine andere Lösung verfolgt.
2.2 Was muss sich bei einem Umbruch in der Schöpfung geändert haben?
Wird 1. Mose 1-11 also historisch-faktisch verstanden, erhebt sich die Frage, wie ein Umbruch von der Ursprungsökologie (ohne Tod) in die heutige Ökologie (mit Tod) vonstatten gegangen sein könnte. Es soll ausgeschlossen werden, dass Gott Fallsgestaltiges am Anfang geschaffen und damit von vornherein gewollt hat, denn dies bedeutete, dass es zur Schöpfung wesensmäßig gehörte. Wenn also das Zeugnis von 1. Mose 1,30 (Tiere und der Mensch haben nur Pflanzennahrung zu sich genommen) im Sinne einer realen Phase in der Geschichte der Erde verstanden wird, so muss man sich zunächst vor Augen halten, welche heute existierenden Strukturen und Verhaltensweisen und ökologischen Beziehungen in eine Ursprungswelt ohne Tiernahrung nicht passen. Welche Unterschiede müssen zwischen der ursprünglichen und heutigen Tier- und Pflanzengestalt und Ökologie aufgrund des biblischen Zeugnisses angenommen werden?
Die Antwort darauf lautet in einer allgemeinen Form: Alle Strukturen und Verhaltensweisen, die ausschließlich zum Finden, Erbeuten, Verzehren und Verdauen lebendiger tierischer Nahrung benötigt werden, haben in der ursprünglichen Schöpfung keinen Platz (fallsgestaltige Strukturen).
Lassen wir dazu einige Beispiele Revue passieren, die in einer „sehr guten“ Schöpfung größtenteils keinen Platz gehabt hätten (Details im Artikel |0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung|: Die Nahrungsketten bzw. -netze mussten viel einfacher gewesen sein; zum Erwerb tierischer Nahrung erforderliche Strukturen und Verhaltensweisen waren nicht ausgebildet, ebensowenig Strukturen und Verhaltensweisen der Feindabwehr (Tarnung, Mimese, Mimikry, Täuschungsmanöver, zur Abwehr geeignete Körperteile usw.). Krankheiten und Missbildungen – der Tribut, den eine Höherentwicklung „zahlen“ muss – gab es nicht. Folglich gab es entweder keine Mutationen oder nur neutrale oder konstruktive, sozusagen „vorgeplante“ Erbänderungen, die keine Nachteile für ihre Träger mit sich brachten. Das heißt, dass das Genom (und der Stoffwechsel) nicht störungsanfällig war, was unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen und auf der Grundlage der heutigen chemischen und biologischen Abläufe undenkbar erscheint.
Damit einher geht die Abwesenheit von Mechanismen der Krankheitsabwehr; ein Immunsystem war also nicht notwendig oder hatte eventuell andere Aufgaben zu erfüllen. Es konnte keine Parasiten gegeben haben, keine Viren, keine Rückbildungserscheinungen, keinen Artentod, und mindestens der Mensch sollte auch nicht individuell sterben.
Angesichts dieser Unterschiede zwischen einer Ursprungs- und der Rezent-Ökologie erscheint es unmöglich, den Aufbau und die Gesetze der Biosphäre vor dem Sündenfall anschaulich zu beschreiben. Wir können uns keine Begriffe von einem Ökosystem machen, in dem die in 1. Mose 1,30 angedeuteten Zustände herrschen. Da die Heilige Schrift uns hierüber nicht näher informiert und uns die Möglichkeit einer Untersuchung ursprünglicher ökologischer Zusammenhänge verwehrt ist, muss der sogenannte „Urstand“ ganz im Dunkeln bleiben. Die ursprüngliche Schöpfung vor dem Fall ist und bleibt ein echtes Geheimnis. Daher ist es auch nicht möglich, einen Übergang von der ursprünglichen zur heutigen Ökologie auszumalen. Es können lediglich unhaltbare Vorstellungen abgewiesen werden, ohne eine positive Antwort („so war es“) dagegenstellen zu können. Dennoch soll ein spekulativer Deutungsversuch vorgestellt werden, der jedoch nur als Denkhilfe zu verstehen ist und nicht als Versuch, etwas gedanklich in den Griff zu bekommen, was jenseits des Begreifens und der Begriffsmöglichkeiten des Menschen liegt. Im Folgenden sollen einige Antwortversuche skizziert und kommentiert werden.
2.3 Entwicklung zur fallsgestaltigen Lebensweise?
Ein aus biologischen Gründen nur in manchen Fällen vertretbarer Deutungsversuch ist die Annahme einer allmählichen Entstehung der Raubtiergestalt bzw. der räuberischen Lebensweise durch mikroevolutive, empirisch bekannte Prozesse nach dem Sündenfall. (Zum Begriff „Mikroevolution“ siehe Artikel |1.3.1.3.1 Mikro- und Makroevolution|.) Schon bei der Erklärung des Raubtiergebisses (s. Abb. 124) stößt man hier aber auf kaum überwindbare Erklärungsschwierigkeiten, wenn man davon ausgehen wollte, dass es ein umgebildetes Pflanzenfressergebiss und durch bekannte Variationsprozesse entstanden sei.

Abb. 124: Fleisch- und Pflanzenfressergebiss. Fleischfressergebiß (Löwe; oben) und Pflanzenfressergebiss (Pferd; unten).
Viel deutlicher wird die Problematik in anderen Fällen, etwa bei fleischfressenden Pflanzen. Stellvertretend für die vielen anderen soll dieses Beispiel diskutiert werden: Die Strukturen, die (etwa bei der Venusfliegenfalle) das Fangen und Verdauen tierischer Nahrung ermöglichen, müssen vollständig ausgebildet sein, damit sie ihren Dienst erfüllen können. Im Artikel |0.5.2.1 Todesstrukturen in der Schöpfung| wird als Beispiel die Kannenpflanze (128 Abb.) beschrieben. Eine andere nicht-destruktive Funktion dieser Fallen ist in den meisten Fällen kaum denkbar. Die Notwendigkeit des Abgestimmtseins aller Fallenteile aufeinander wird auf der einen Seite zurecht als Argument gegen eine allmähliche evolutive Entstehung dieser Strukturen während einer Stammesgeschichte ins Feld geführt. Damit schließt man aber gleichzeitig eine sündenfallbedingte allmähliche Bildung aus. Da eine separate Neuschöpfung aus biblischen Gründen ebenfalls auszuschließen ist, muss nach anderen Ursachen gefragt werden.

Abb. 128: Das Kannenblatt der Kannenpflanze (Nepenthes)
Die Vorstellungen eines allmählichen Umbruchs scheitert außerdem an der Tatsache, dass alle Lebewesen ökologisch durch Fressen und Gefressenwerden miteinander verbunden sind. Ein allmählicher Übergang von einem ganz anders organisierten Ökosystem in heutige komplizierte Bedingungen entzieht sich ebenfalls einer Erklärung durch bekannte biologische Prozesse.
Es soll und kann damit nicht ausgeschlossen werden, dass ein allmählicher Übergang von einem nicht-fallsgestaltigen Stadium aus in einzelnen Fällen denkbar ist oder wahrscheinlich gemacht werden kann. Die heute empirisch bekannten Phänomene im Bereich des Lebendigen liefern jedoch in der Regel keine Analogien für einen Umbruch der ursprünglichen in die heutige Ökologie. Es handelt sich offenbar um ein Geschehen, das jenseits aller Erfahrung und Vorstellbarkeit liegt. Die anstehende Frage ist damit naturwissenschaftlich vermutlich nicht lösbar.
Polyfunktionalität. Ein interessantes Phänomen ist in diesem Zusammenhang Polyfunktionalität: Organe haben gewöhnlich mehrere Funktionen. Beispielsweise dienen Stacheln und Dornen nicht nur als Hindernisse gegen Verzehrer, sondern sind auch Kondensationskerne für Tau. Sie helfen also bei der Wasserversorgung der Pflanzen.
Im Kannenblatt der Kannenpflanze (s. o. Abb. 128) werden nicht nur Insekten verdaut, sondern die Flüssigkeit dient vielen anderen Insekten als Nährsubstanz für ihre Larven, die dort ihre Entwicklung unbeschadet durchmachen.
Spinnennetze sind auch geeignet, Pollen zu fangen, und es gibt auch pollenfressende Spinnen.
Interessant ist in unter diesem Aspekt auch der Daumen des Iguanodon. Dieser Dinosaurier besaß eine einzigartige Hand (s. Abb. 133), „die im gesamten Tierreich ihresgleichen sucht“ (D. Norman). Der spitze Daumen konnte wohl als Waffe gegen Beute oder Feinde eingesetzt werden, war aber gleichzeitig auch für das Bearbeiten von Früchten geeignet.

Abb. 133: Polyfunktionalität am Beispiel des Daumens des Iguanodon.
Ein Übergang in die Bedingungen nach dem Sündenfall könnte in solchen Fällen wenigstens teilweise durch Entartung verstehbar sein. Beispielsweise könnte das Kannenblatt schon immer der Fürsorge für manche Larven gedient und erst nach dem Fall auch destruktive Merkmale ausgeprägt haben. Das muss natürlich spekulativ bleiben, doch zeigen solche Beispiele, dass manche fallsgestaltige Strukturen auch in einer Welt ohne Fressen und Gefressenwerden von Tieren einen konstruktiven Platz eingenommen haben können.
2.4 Sprunghafte Veränderungen?
Im Weiteren soll nun ein Denkansatz vorgestellt werden, in dem bewusst der Argumentationsspielraum der Erfahrungswissenschaften verlassen wird. Dabei soll der Spekulation jedoch nicht freier Lauf gelassen werden, sondern einerseits die biblisch bezeugte Realität einer unsichtbaren Wirklichkeit in Rechnung gestellt und andererseits auf das heute verfügbare biologische Wissen zurückgegriffen werden.
Fremdbestimmung der Lebewesen. Dieser Deutungsversuch nimmt auf die Erkenntnis der Biologie Bezug, dass die Lebensprozesse hierarchisch organisierten Steuerungen unterliegen. Schon im Erbgut muss zwischen Strukturgenen und Regulatorgenen unterschieden werden. Die Strukturgene stehen für Eiweiße (Bau- oder Stoffwechselproteine), die Regulatorgene für solche Proteine, die beim kontrollierten Ablesen der Strukturgene benötigt werden. Doch die Regulatorgene steuern selber nicht. Sie sind lediglich eine notwendige Voraussetzung dafür, dass die Information auf den Strukturgenen kontrolliert abgelesen und für den Zellstoffwechsel nutzbar gemacht werden kann. Die Regulatorgene bedürfen ihrerseits der Regulation. Dies geschieht z. B. durch Hormone, das sind Botenstoffe, die über die Blutbahn zirkulieren. Diese aber wiederum müssen selber von einer noch höheren Instanz reguliert werden und so weiter. Man kann also festzuhalten, dass man nach bisherigen Forschungsergebnissen davon ausgehen muss, dass das Erbgut und die vorgeschalteten Steuerungen hierarchisch strukturiert sind. (Das ist stark vereinfacht dargestellt; die tatsächliche Situation ist durch Rückkopplungen und vernetzte Beziehungen viel komplizierter, doch tut das für die hier verfolgte Fragestellung nichts zur Sache.)
Jede Hierarchiestufe (Strukturgen – Regulatorgen – Hormon – Gehirn – …) kann auf ihrer eigenen Ebene nicht verstanden werden. Vielmehr wird eine Art Sollwertgeber von „außen“ benötigt, womit immer wieder auf eine höhere Ebene verwiesen wird. Was aber ist die höchste Instanz? Kann sie überhaupt materiell in den Lebewesen gefasst werden? Es stellte sich dann sofort die Frage, was diese Instanz wiederum in Aktion versetzt.
Anwendung: Wie entstanden die fallsgestaltigen Strukturen? Man könnte sich in der anstehenden Frage nach dem Übergang in die Bedingungen und Strukturen nach dem Fall folgendes denken: Die genetischen Grundlagen (die Bausteine als solche) wurden im Gefolge des Sündenfalls nicht geändert, die Instanz aber, die ihren Zusammenbau regelt, reagiert auf die veränderten Lebensbedingungen nach dem Fall. Mit demselben „Baumaterial“, also auf derselben genetischen Grundlage, werden verschiedenartige „Gebilde“ errichtet. Die höchste Instanz also, die die individuelle Entwicklung, den Bau und die Funktionsweisen der Lebensäußerungen regelt, könnte eine Wandlung erfahren haben, so dass unter den neuen Bedingungen nach dem Sündenfall bei vielen Lebewesen neue – fallsgestaltige – Strukturen zum Vorschein kommen.
Dies ist damit vergleichbar, dass man aus demselben Baumaterial ein Rathaus, eine Kirche oder ein Gefängnis bauen kann.
Modell aus der heutigen Biologie. Für diese Vorstellung gibt es ein interessantes Modell aus der heutigen, uns bekannten Biologie: die fremddienliche Zweckmäßigkeit, wie sie in bestechendster Form bei Pflanzengallen zu beobachten ist. Gallen sind spezifisch geformte Gebilde, die vor allem auf Blattoberflächen durch Einwirkung fremder Stoffe (von Bakterien, Pilzen oder Tieren) entstehen. So bildet beispielsweise die Rose nach einem Stich und der Eiablage der Rosengallwespe sog. „Rösenäpfel“ (s. Abb. 134), büschelige Gebilde, in deren Innern sich einige Kammern für die darin sich entwickelnden Larven befinden (s. Abb. 135). Es gibt eine reiche Formenvielfalt unter den Gallen. Manche gleichen spitze Hörnern, andere länglichen Zwiebeln, kugelrunden Murmeln, flachen Sonnenhüten, goldglänzenden Münzen oder Knöpfen (s. Abb. 136). Wichtig ist: Es werden Formen gebildet, die die Wirtspflanze sonst nicht erzeugt. Am gleichen Blatt können sogar verschiedene „Galltiere“ Gallen völlig unterschiedlicher Gestalt hervorrufen. Die neuen Entwicklungswege werden oft mit äußerster Präzision beschritten. Der Stoffwechsel wird zugunsten der Produktion bestimmter Inhaltsstoffe (z. B. Gerbstoffe) umgestellt, manche Wege werden intensiviert, andere verschlossen oder Seitenwege eingeschaltet.

Abb. 134: Ein Rosenapfel (Galle), der von der 3 mm langen Gemeinen Rosengallwespe hervorgerufen wird.

Abb. 135: Der Blick in das Innere eines Rosenapfels offenbart ein Röhrensystem, in dem Larven leben.

Abb. 136: Seidenknopfgallen an der Unterseite eines Eichenblattes, hervorgerufen durch eine Gallwespe
Als Auslöser für die Gallbildung dient den verschiedenen Schmarotzerarten ein Wuchsstoff. Erbsubstanz (DNS) wird jedoch nicht übertragen. I. a. sind die Gallen in komplizierter Weise den Bedürfnissen des Gastes angepasst. Dazu gehören ein passender Hohlraum, ein widerstandsfähiges Gehäuse, zartwandige, der Ernährung dienende Zellen im Innern der Gallen, die Erzeugung bitterer Stoffe, die Vögel oder Raupen vom Fressen abhalten, sowie z. T. die Ausbildung einer Trennschicht, die das Öffnen der Galle ermöglicht, sobald die Insassen zum Ausschwärmen alt genug sind (vgl. Abb. 137).

Abb. 137: Ein fertiges Gallinsekt in einer aufgeschnittenen Eichengalle.
Wer hat hier das Sagen? Was geschieht hier? Unter dem Einfluss auslösender Substanzen wird das Baumaterial der Wirtspflanze zum Bau artfremder Strukturen verwendet. Die Gallen ähneln in ihrer Form gewöhnlich irgendwelchen normalen Pflanzenstrukturen nicht im entferntesten. Aber die genetische Grundlage der Pflanzen ist nicht verändert worden. Es werden keine Gene in die Pflanzen injiziert, es erfolgt keine Gentransplantation. Die Gene und der Zellstoffwechsel geraten offenbar unter „fremde Herrschaft“ und werden entsprechend genutzt.
Diesen Beispielen entsprechend könnte man sich denken, dass die geschaffenen Organismen durch den Sündenfall unter eine neue „Herrschaft“, unter eine Art Anpassungstrieb an die Bedingungen „dieses Äons“ gerieten und dadurch ihre Lebensweise änderten. Dieser „Herrschaftswechsel“ muss synchron und bei den verschiedenen Arten aufeinander abgestimmt erfolgt sein, so dass ein nahtloser Übergang in die Ökologie nach dem Sündenfall möglich war. Wichtig ist bei diesem Lösungsversuch, dass die Identität der Arten und Individuen gewahrt bleibt. Zugleich wird so verstehbar, dass das neue komplizierte ökologische Gefüge in seiner Fallsgestaltigkeit koordiniert „zusammengesetzt“ wurde.
Zur Vermeidung eines möglichen Missverständnisses soll noch erwähnt werden, dass Gallenbildung selber nicht als fallsgestaltiges Phänomen zu werten ist, sondern eine Symbiose [= Zusammenleben ohne einseitige Schädigung] darstellt. Das Beispiel soll nur als Illustration dienen, wie sich unter dem Einfluss einer fremden „Größe“ die Gestalt wandeln kann.
Die Theodizee-Frage im Rahmen dieses Erklärungsversuchs. Im Rahmen dieses Lösungsversuchs muss nicht angenommen werden, Gott habe (unmittelbar oder latent) fallsgestaltige Anlagen erschaffen. Das „sogenannte Böse“ (K. Lorenz) musste in keiner Weise „vorgebildet“ gewesen sein. Außerdem bleiben die Individualitäten erhalten; es erfolgt keine Neuschöpfung. So gesehen ist dieser Versuch theologisch befriedigend.
Zur Frage, wer für den beschriebenen „Herrschaftswechsel“ und das neue ökologische Gefüge verantwortlich zeichnet, sei an die Diskussion zum 8. Kapitel des Römerbriefs im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| verwiesen. Die geschilderte Deutung kann die „Unterwerfung“ der Schöpfung veranschaulichen, von der in Römer 8,19ff. die Rede ist.
2.5 Die Gestalt der Lebewesen: Wer ist der Steuermann?
Der geschilderte Deutungsversuch wirft im weiteren die Frage auf: Was ist der Garant für die Erhaltung der Individualität der Lebewesen beim Übergang in die fallsgestaltige Lebensweise? Zur Antwort ziehen wir nochmals den Vergleich mit der Gallenbildung heran. Die aufgeworfene Frage stellt sich nämlich sehr ähnlich angesichts der Gallenbildung oder auch der Metamorphosen von Lebewesen (z. B. Verwandlung von Larve zum erwachsenen Insekt): Was garantiert bei der „Umschmelzung“ einer Raupe in eine geflügelte Form die Individualität? Die empirischen Wissenschaften können hierzu nur negative Antworten geben: Etwa: Die Erbfaktoren sind es nicht, denn sie reagieren nur auf Impulse von „außen“; oder: Hormone (im Körper zirkulierende Botenstoffe) sind es nicht, denn auch sie bedürfen ihrerseits einer Steuerung usw.
Für den Menschen hat der Embryologe Erich Blechschmidt ein „Gesetz der Erhaltung der Individualität“ aufgestellt. „Nur was in seinem Wesen bereits ist, kann sich entwickeln.“ Aufgrund seiner ausgiebigen Studien gelangt er zur Sichtweise, dass nicht Stoffe (etwa DNS), sondern Gestaltungskräfte die unmittelbaren Motoren der Formbildung der Lebewesen sind. Der menschliche Embryo entwickelt sich – wie Blechschmidt formulierte – durch Arbeit gegen Widerstand.
Es bietet sich an, dieses „Gesetz der Erhaltung der Individualität“ auf Tiere und Pflanzen auszudehnen und auf die o. g. Beispiele anzuwenden. Allerdings entzieht sich in allen Fällen das steuernde, die Individualität garantierende Agens [= steuernde Größe, handelnde Instanz] der wissenschaftlichen Verobjektivierung, d. h. sie kann nicht in exakten Gesetzmäßigkeiten eingefangen werden. Doch um die Lebensäußerungen der Organismen verstehen zu können, ist das Postulat [= Forderung] eines steuernden Agens sinnvoll. Man könnte es die „Ganzheit“ oder die „Steuerinstanz“ eines Organismus nennen oder vom „handelnden Organismus“ sprechen. Noch einmal: Es ist nicht möglich, unter Reduktion auf Teilsystemebenen der organismischen Ganzheiten die Organismen zu verstehen. Das „Gesetz von der Erhaltung der Individualität“ ist nur durch einen Negativbeweis begründbar. Die „steuernde Instanz“ (die gestaltende Kraft) kann nicht vorgezeigt, sondern nur an ihren Wirkungen erkannt werden.
Kommen wir auf die aufgeworfene Frage zurück: Als Denkhilfe zum Verständnis des Übergangs von der ursprünglichen in die heutige Ökologie kann man mit dieser Terminologie [= Begrifflichkeit] sagen: Unter den neuen Bedingungen nach dem Fall verwirklichen die Ganzheiten der Organismen angepasste Gestalten – und zwar „geknechtete Gestalten“ (Röm 8,19ff.), die dem „Schema dieser Welt“ (1. Kor 7,31), der gefallenen Schöpfung angepasst sind.
2.6 Physikalische Rahmenbedingungen
Ein ursprünglich wesensmäßig anderes Ökosystem bedurfte auch anderer physikalischer Rahmenbedingungen als der heutigen. Ohne Tod konnte es auch keine Todesgefahren gegeben haben. Beispielhaft soll das am Los der Frau beim Gebären (1. Mose 3,16) kurz angedeutet werden.
Was war anders, als das Gebären noch nicht schmerzvoll war? Man könnte sich denken, dass die Eigenschaften der Materie von den heutigen Eigenschaften verschieden waren, sodass die anatomischen Merkmale sich nicht schmerzhaft und gefahrvoll auswirkten. Denkbar wäre auch, dass die körperliche Konstitution anders war, so dass die Schmerzen und Gefahren ausgeschlossen waren. Doch wäre der Anatom kaum in der Lage, eine andere Konstruktion anzugeben, die (unter den heutigen Lebensbedingungen des Menschen) besser wäre als die tatsächlich realisierte. Ein breiterer Beckenring hätte vermutlich anderweitige Nachteile; so wäre es wohl schwieriger, aufrecht gehend die Last des Kindes im Mutterleib zu tragen. Bis zum Beweis des Gegenteils wird man davon ausgehen müssen, dass die körperliche Konstitution des Menschen unter den gegebenen Umständen der Lebensbedingungen nach dem Fall(!) der beste Kompromiss ist, jedoch kein Kompromiss der Evolution, sondern ein Kompromiss im Rahmen einer „Notordnung“ Gottes nach dem Fall.
Der Auferstehungsleib Jesu. Eine Gedankenhilfe dafür, dass eine andere Leiblichkeit als die uns bekannte möglich ist, bieten die neutestamentlichen Berichte von der Auferstehung Jesu. Einerseits wird in diesen Schilderungen großen Wert darauf gelegt, dass Jesus leiblich auferstand (er konnte angefasst werden, er aß etwas), andererseits wird bezeugt, dass Jesus durch geschlossene Türen gehen konnte. Wenn wir das versuchen würden, gäbe es mindestens blaue Flecken. Jesu Auferstehungsleiblichkeit war offenbar eine andere, wie auch der Auferstehungsleib der Gläubigen von anderer Qualität sein wird (vgl. 1. Kor 15,42+43). So kann man sich denken, dass die Leiblichkeit des Menschen, die noch nicht durch die Sünde betroffen war, von der heutigen Beschaffenheit verschieden war. Dabei kann jedoch nichts Sicheres darüber gesagt werden, inwiefern die ursprüngliche Leiblichkeit vor dem Sündenfall der künftigen Auferstehungsleiblichkeit gleicht.
2.7 Die zwei Gesichter der Schöpfung – Widerspiegelung des Menschen
„Dieser Zustand der Natur ist die notwendige Widerspiegelung des Zustandes der Menschenwelt: ihrer Gier, ihrer Zertrennung, ihres Kampfes der falschen Absolutheiten, ihrer Dämonisierung und Satanisierung“ (L. Ragaz).
Weshalb ist die ganze Schöpfung in den Fall des Menschen mit hineingerissen worden? Eine letztgültige Antwort auf diese Frage soll nicht gegeben werden und ist wohl auch nicht möglich. Römer 8,19ff. hebt diesen Zusammenhang nur hervor, ohne ihn näher zu begründen. Im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| wurde bereits auf die schöpfungsgemäße Sonderstellung des Menschen hingewiesen. Wenn das wichtigste Schöpfungswerk „verdorben“ ist, ist alles verdorben, was mit ihm verbunden ist – eben die ganze Schöpfung.
Aus der Verbundenheit zwischen der außermenschlichen Schöpfung und dem Menschen folgt: Die Schöpfung ist eine Widerspiegelung des Menschen und seiner Situation. Die Schöpfung kann sich nicht selber aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreien, sondern wartet auf den Befreier. Genauso ist es um den Menschen bestellt. Er ist nicht aufgrund eigener Möglichkeiten in der Lage, die Lebensverhältnisse grundlegend zu wandeln, auch er ist von der Vergänglichkeit geknechtet. Alle durchaus notwendigen und richtigen Bemühungen um Verbesserungen der menschlichen Existenz stehen letztlich unter dieser Feststellung. Sie soll nicht zur Resignation führen, sondern zu einem Realismus. Denn in Römer 8,19-22 wird nicht nur eine ernüchternde Diagnose gegeben, sondern auf eine Therapiemöglichkeit hingewiesen. Gott selber, der Unterwerfer, wird auch befreien. Es kann also nur darum gehen, sich dem Schöpfer und seiner Führung anzuvertrauen. Darauf soll uns das „verkehrte“ Gesicht der Schöpfung hinweisen: dass wir ohne Gott auf dem verkehrten Weg sind und seine Befreiung benötigen. Warum seufzt die ganze Schöpfung? „Nicht freiwillig“, sondern „um des willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat“. Damit sind wir gemeint.
Wenn wir uns über das Seufzen der ganzen Schöpfung wundern, soll das zum Nachdenken über uns selber und letztlich zur Sündenerkenntnis führen, d. h. zur Einsicht, dass es der Grundfehler schlechthin ist, nicht nach Gott und seinem Willen zu fragen.
Für unser Denken und unser Handeln gibt es Grenzen, die unübersteigbar sind: der Cherub steht vor der Tür (1. Mose 3,24). Es kann nicht anders sein, als dass Fragen über die Anfänge offen bleiben müssen. Der Weg zu Gott führt über den Weg der Umkehr des Herzens. „Das Schwert des Cherubs trifft jeden, der eigenmächtig in das Paradies zurück will, – sei es denkend, sei es handelnd, sei es mystisch – denn sie alle verkennen Schuld und Sühne; sie wollen anders zu Gott als auf dem Weg totaler Buße“ (H. Echternach).
Der Zugang zum Schöpfer ist offen, weil Jesus Christus durch sein Sterben und seine Auferstehung diesen Weg eröffnet hat. Jesu Auferstehung bedeutet die Überwindung
2.8 Zusammenfassung
Nach dem Zeugnis der Bibel ist die Welt gefallene Schöpfung und die Daseinsweise der Lebewesen nicht einfach das Ergebnis natürlicher Prozesse. Es wird ein wesensmäßiger Unterschied zwischen der Ursprungswelt bzw. der zukünftigen Schöpfung und der Jetztgestalt der Schöpfung bezeugt. Ökologische Stabilität ist unter den Bedingungen der Jetztzeit („dieses Äons“) nur mit dem Beiklang des Seufzens (Rom 8,19ff.) möglich. Die Frage nach dem Übergang von einer ursprünglichen in die heutige Ökologie ist auf der biologischen Ebene nicht zu beantworten, da es keine entsprechende Erfahrungen aus dem heutigen, uns zugänglichen Bereich gibt. Ein allmählicher Übergang von der ursprünglichen in die heutige Lebensweise der Organismen kommt in der Regel nicht in Frage; es ist meist nur ein abrupter Umbruch denkbar, der die Bedingungen des jetzigen Daseins umfassend ändert. Aus der heutigen Biologie können vage Modelle für diesen Umbruch entnommen werden. Nach einer theologisch befriedigenden Modellvorstellung gerieten die Lebewesen im Gefolge des Sündenfalls unter „Steuerungsinstanzen“, die dem Ursprungsdasein „fremd“, dem jetzigen Dasein ausdrucksgemäß sind.
Diese Deutung beruht auf der Einsicht, dass Organismen letztlich willensgesteuert sind, wobei das agierende Subjekt naturkundlich zwar nicht fassbar, jedoch aufgrund empirischer [= auf Erfahrung beruhend] Phänomene postuliert [= gefordert] werden muss. Durch diesen Deutungsansatz sind tiefgreifende Organisationsänderungen und Änderungen der Lebewesen verstehbar, ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Schöpfung und ohne die Annahme, dass den Lebewesen schon ursprünglich, in der „sehr guten“ Schöpfung bereits genetische Grundlagen für eine andere Lebensweise „eingebaut“ waren. Damit kann der Schluss vermieden werden, dass der Schöpfer ursprünglich bereits fallsgestaltige Merkmale (bzw. genetische Grundlagen dafür) geschaffen habe, was dem Urteil „sehr gut“ (1. Mose 1,31) widersprechen würde. Letztlich stehen also steuernde Instanzen hinter dem nur in Teilaspekten verobjektivierbaren Lebensgeschehen, deren Wirken Gott in der gesamten Schöpfung im Gefolge des Sündenfalls zugelassen hat.
2.9 Literatur
Junker R (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Neuhausen-Stuttgart.
Junker R (2001) Sündenfall und Biologie. Schönheit und Schrecken der Schöpfung. Neuhausen-Stuttgart.
Autor: Reinhard Junker, 16.04.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/e2043.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/
0.5.2.4 Das Theodizee-Problem
Mit der Theodizee-Frage ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Übels in der Welt gemeint. Wie kann ein guter und allmächtiger Gott so viel Leid zulassen? Eine einfach und rational voll befriedigende Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Die biblische Urgeschichte (1. Mose 1-11) gibt jedoch eine Teilantwort. Die Theodizee-Frage ist eng mit dem Zeugnis von Gott als Schöpfer verbunden.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird die Theodizee-Frage aufgeworfen. Traditionelle Antworten werden kurz angesprochen. Die biblische Urgeschichte und das Schöpfungszeugnis im Buch Hiob werden als besondere Schlüssel zum Verständnis herausgestellt.
1.1 Problemstellung
Bei der Theodizee-Frage geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Sie stellt sich aufgrund des biblischen Zeugnisses, dass einerseits Gott gut und allmächtig ist, dass aber andererseits das Böse existiert. Wie aber kann ein guter Gott so viel Leid in seiner Schöpfung verursachen oder zulassen? Das immense Leid scheint entweder gegen seine Allmacht oder gegen seine Güte zu stehen. Diese Frage ist einerseits angesichts des immensen Leides in der Welt verständlich, andererseits wird sie oft gestellt, um Gott auf die Anklagebank zu setzen, was sich angesichts der Majestät und Gottheit des Schöpfers verbietet. Die Frage stellt sich aber auch aus existenzieller Betroffenheit und hat dann eine seelsorgerliche Dimension. Vor diesem Hintergrund sollen die nachfolgenden Ausführungen verstanden werden.
1.2 Antwortversuche
Die Theodizee-Frage wird oft dadurch zu lösen versucht, dass man auf die Freiheit des Menschen hinweist. Ohne Freiheit sei Liebe nicht zu verwirklichen. Diese Freiheit berge aber das Risiko des Scheiterns. Doch hier kann man weiterfragen, ob dieses Risiko nicht vermeidbar wäre, ohne die Liebe in Freiheit zu verlieren. Diese Antwort ist also nicht rundum befriedigend, und sie stößt schnell an die Grenzen des Denkens.
Manche Autoren versuchen die Problematik zu entschärfen, indem sie zwischen „natürlichem“ und moralischem Bösen unterscheiden. Letzteres sei Resultat der menschlichen Freiheit. Ersteres stamme aus dem Gefüge der heilen Schöpfung Gottes selbst und sei notwendig, damit es eine relativ unabhängige Schöpfung überhaupt geben könne. Aber auch hier kann man wieder weiterfragen: Hätte ein allmächtiger Schöpfer nicht doch eine anders geartete Schöpfung erschaffen können?
Auf die Theodizee-Frage gibt es keine einfachen Antworten. Eine Antwort, die das Theodizee-Problem argumentativ und für jeden einsichtig löst, ist nicht in Sicht. Es scheint nur möglich zu sein, die negative Antwort auf die Theodizee-Frage (nämlich: „Es gibt keinen guten und allmächtigen Gott“) argumentativ abzuweisen, z. B. indem auf die begrenzte Einsicht des Menschen hingewiesen wird. Gott kann von der menschlichen Logik nicht berechnet werden, weil seine Gedanken höher sind als die der Menschen. Der Glaube verliert damit aber nicht seine Rationalität, wenn er sie in den Rahmen der Majestät Gottes stellt. Diese ist immer vorrational, so wie bei jeder Weltanschauung ein vorrationales oder religiöses Element vorgeschaltet ist.
1.3 Evolution verschärft das Theodizee-Problem
Das Theodizee-Problem wird in einer theistisch-evolutionär verstandenen Welt, in welcher sich Schöpfung durch einen Evolutionsprozess vollzieht, noch verschärft. Die Theodizee-Frage stellt sich in dieser Sichtweise nämlich auch folgendermaßen: Wie kann an Gottes Gerechtigkeit und Güte festgehalten werden, wenn Gott über hunderte von Millionen Jahren Krankheit, Missbildung, Grausamkeit, Tod, Artentod, und zuletzt (beim Menschen) auch Sünde eingesetzt hat, um die Lebewesen hervorzubringen? Sünde erscheint hier als Nebenprodukt des evolutionären Prozesses (so Teilhard de Chardin und viele andere in seinem Gefolge) (vgl. Artikel |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament|). Das Übel erscheint demnach nicht als „Einbrecher“ in eine ursprünglich leidfreie Schöpfung, sondern von vornherein als ihr Hausherr.
Im theistisch gedeuteten evolutionären Kontext erscheinen Leid und Tod als Schöpfungsmittel und nicht als Ausdruck und Folgen des göttlichen Gerichts über die Sünde des Menschen – biblisch gesehen ein wesentlicher Aspekt. In diesem Sinne muss von einer Verschärfung des Theodizee-Problems gesprochen werden – mehr noch: es stellt sich hier die Frage, ob im Rahmen einer evolutionär verstandenen Schöpfung, in welcher Sünde und Tod Schöpfungsmittel sind, die Theodizee definitiv zunichte gemacht wird. Vorsichtig ausgedrückt: Die Möglichkeiten, die Theodizee zu verteidigen, sind zusätzlich zu den ohnehin vorhandenen argumentativen Schwierigkeiten weiter eingeschränkt.
1.4 Die biblische Urgeschichte als Teilantwort
Man kann durchaus die biblische Urgeschichte (1. Mose 1-11) als Teilantwort auf die Theodizee-Frage verstehen. Die biblische Urgeschichte gibt Auskunft, auf welchem Wege und durch welche Umstände das Böse in die Welt des Menschen kam. Gerhard von Rad sieht das Hauptanliegen der Paradieses- und Sündenfallerzählung darin, dass Gott und seine Schöpfung freigesprochen werden sollen von all dem Leid und der Mühsal, die in die Welt gekommen sind. Diese Erzählung wolle „zeigen, wie aus der Schöpfung das Chaos des gestörten Lebens geworden ist, das uns heute umgibt.“ (Von Rad versteht diese Aussage allerdings als Glaubensaussage, nicht wie der Verfasser als Seinsbestimmung.) Durch die Sünde des ersten Menschenpaares ist der Tod mit seinen Begleiterscheinungen in die Schöpfung eingedrungen. Die Fluchworte Gen 3,16-19 stellen klar, dass lebenseinschränkende Umweltbedingungen Folge des Falles und nicht Ordnung der ursprünglichen guten Schöpfung Gottes sind. Ebenso löste vermutlich auch die Sintflut weitere Beschränkungen der Lebensmöglichkeiten aus. Genesis 1-11 versteht sich somit insgesamt als Begründung der jetzigen Seinsverfasstheit.
Allerdings ist die Antwort der biblischen Urgeschichte auf die Theodizee-Frage unvollständig: Es wird z. B. nicht gesagt, woher der Versucher (1. Mose 3) kam. Andeutungen im Alten Testament sind zu vage, um klare Antworten geben zu können. Viele andere Fragen wie etwa die nach dem Ausmaß des Leides, werden ebenfalls nicht beantwortet.
1.5 Einwand
Gegen diese „christliche Standardantwort“ werden die Ergebnisse evolutionstheoretischer Forschung gestellt, wonach es keine paradiesische Zeit und keinen Sündenfall mit geschöpflichen Auswirkungen in der Menschheitsgeschichte gegeben habe. An dieser Stelle sei in aller Kürze darauf hingewiesen, dass das evolutionäre Verständnis vom Werden der Menschheit keinen Absolutheitsanspruch erheben kann. Die Geschichte der Menschheit und der übrigen Lebewesen steht einer direkten empirischen Untersuchung nicht offen; vielmehr werden Indizien (z. B. Fossilfunde) in einem vorgegebenen Deutungsrahmen interpretiert. Dieser Deutungsrahmen kann grundsätzlich unterschiedlich gewählt werden – auch in Form des traditionellen christlichen Verständnisses von der Urgeschichte der Menschheit. Dass hierbei wesentliche Fragen derzeit unbeantwortet sind, soll nicht verschwiegen werden; es wurde jedoch nach der Durchsetzung des evolutionären Naturverständnisses vergleichsweise sehr wenig versucht, in diesem Deutungsrahmen die naturkundlichen Daten zu deuten.
1.6 Theodizee und Schöpfung
Dass die Bezugnahme auf Gott als Schöpfer in der Theodizee-Frage von besonderer Bedeutung ist, wird in demjenigen Buch der Bibel besonders deutlich, welches sich ausdrücklich mit der Theodizee beschäftigt: dem Buch Hiob. Wer dort eine rational nachvollziehbare Antwort auf die Frage des Leides erwartet, wird jedoch enttäuscht. Alle im Gespräch der Freunde Hiobs mit dem leidgeprüften Mann vorgetragenen Argumente werden von Hiob und schließlich von Gott selber in seiner Antwort (Buch Hiob, Kap. 38 ff.) abgewiesen. Gott gibt den Freunden Hiobs, die durch moralische oder philosophische Argumente das Böse gleichsam gedanklich in den Griff bekommen wollten, ausdrücklich unrecht.
Das Festhalten an der Theodizee scheint daher eine Sache des Glaubens zu sein. Für einen Nicht-Gläubigen ist das freilich eine Provokation, für den Gläubigen nicht selten eine Anfechtung. Dennoch gibt Gott in seiner Rede an Hiob eine gewisse Antwort, indem er auf seine Schöpfung verweist und darauf, dass Hiob bei der Erschaffung nicht anwesend war: „Wo warst du, als ich die Erde gründete?“ (Hiob 38,4). Hiob wird angesichts der Majestät Gottes dazu geführt, seine Unwissenheit zu bekennen. Will Gott damit zum Ausdruck bringen, dass es dem Menschen nicht gegeben ist, die Theodizee rational zu demonstrieren? Will er sagen, dass der Umgang des Geschöpfes Mensch mit dem Leid nur der Weg des Vertrauens in Gottes Souveränität und Gutsein sein kann? Dabei ist Gott vertrauenswürdig, weil er der Schöpfer ist. Ohne das Schöpfungszeugnis verlöre die Antwort Gottes an Hiob ihren Inhalt. Die oft eingeforderte kritisch-rationale Diskussion kann aus christlicher Sicht wohl nur bis zu diesem Punkt geführt werden.
1.7 Theodizee und die Existenz Gottes sowie Schlussbemerkungen
Mit dem Hinweis auf das scheinbar unlösbare Theodizee-Problem wird häufig die Existenz Gottes verneint. Damit wäre das Theodizee-Problem „gelöst“. Doch wenn die Existenz Gottes verneint wird, bleibt die Frage nach der Herkunft der Schöpfung. Noch einmal wird an dieser Stelle die Wichtigkeit des biblischen Schöpfungszeugnisses gerade in der Theodizee-Frage deutlich. Wird Gott nicht mehr als souveräner Schöpfer gesehen – worauf faktisch konsequente theistisch-evolutionistische Entwürfe hinauslaufen – dann entscheidet sich die Theodizee definitiv zuungunsten Gottes.
Ohne dass damit eine Antwort auf die Theodizee-Frage gegeben wird, muss in ihrem Zusammenhang aus biblischer Sicht noch auf zwei Dinge hingewiesen werden:
Jesus Christus nahm selber die Last des Übels an und stellte sich unter die Last der Theodizee-Frage: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt. 27,46)
Die Theodizee-Frage darf nicht losgelöst vom zukünftigen Handeln Gottes und der neuen Schöpfung betrachtet werden; Leid und Tod haben nicht das letzte Wort.
Literaturhinweis:
- Junker: Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Neuhausen-Stuttgart, 1994; Abschnitt 4.7.3.
Autor: Reinhard Junker, 17.05.2004
© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2044.php
Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/